
Die Berichterstattung des Spiegel über Griechenland: Ein kritisches Resümee.
Bei der derzeitigen Berichterstattung über die wirtschaftliche und politische Krise Südeuropas – allen voran Griechenlands – ist auf eine Regelmäßigkeit stets atomuhrenwerkmäßig Verlass: Immer dann, wenn es einem dank Spitzenschlagzeilen wie „Pleitegriechen“ (Bild), „Griechen-Rettung“ (Focus), „Was steht auf der Griechen-Liste?“ (ARD), sowie dem ideologischen Starrsinn und der notorischen Uninformiertheit der hiesigen Leitmedien die Sprache zu verschlagen droht, wissen der Spiegel und seine Ableger in der ihnen eigenen Mischung aus süffisanter Diffamierung und vulgärer Suggestion stets und zuverlässig die bizarren Auswüchse des deutschen Presseneusprechs zu toppen.
Zum Wahlsieg Syrizas im Januar diesen Jahres erreichte das Sturmgeschütz der oberen zehn Prozent Höchstform, als es sich exakt deren Nöte zu eigen machte: „EU-Politiker entsetzt über griechischen Linksschwenk“ – zeigte sich SPON am 29.1. tief besorgt über die Pläne der neuen Regierung, mit Brüssel über einen Schuldenschnitt zu verhandeln, tausende Beamte im öffentlichen Dienst einzustellen und EU-Sanktionen gegen Russland zu blockieren. Denn „Pläne zum Privatisierungsstopp hatten den griechischen Aktienmarkt am Mittwoch stark belastet“ (ebd.).
Bereits eine knappe Woche vorher, am 23.01., hatte der Chef der Euro-Gruppe, Jeroen Dijsselbloem, mittels Spiegel-Interview mit einem „Hilfsstopp“ gedroht, falls ein Regierungswechsel im Mutterland der Demokratie tatsächlich – Gott bewahre! – auch einen Politikwechsel bewirke. „Einfach nur Geld zu geben, ohne die Probleme anzugehen, würde bedeuten, dass Griechenland für immer auf Kredite angewiesen ist.“ (ebd.)
Dass die neue griechische Regierung genau dies versuchte – hatte sich doch dank den seit 2007 durch die Troika aus IWF, EZB und Kommission oktroyierten sogenannten Hilfsmaßnahmen laut OECD die Arbeitslosigkeit von sieben auf 28 Prozent vervierfacht, waren die öffentlichen Schulden von 144 auf 175 Prozent gestiegen, das Wirtschaftswachstum von drei auf minus drei Prozent gefallen, sowie Ungleichheits- und Armutsindikatoren in die Höhe geschnellt – nahmen die bornierten Betonköpfe vom Spiegel selbstverständlich nicht zur Kenntnis. „Höhere Renten, neue Jobs für fast zehntausend bereits gekündigte Staatsbedienstete, zahlreiche Leistungen für Bedürftige, Anhebung des Mindestlohns, Verzicht auf Privatisierungen […]“ seien schließlich, was auch sonst, ein „Reformstopp“, analysierte Florian Diekmann wiederum sumpfklug und tellertief auf SPON am 29.01.
Lieber machte man sich daher am gleichen Tag darüber Gedanken „Wie Europa Tsipras zähmen will“: „Verhandlungen kann es geben, aber nicht als Folge von Erpressung“, kommentierten die militant konformistischen Gedankenakrobaten von SPON allen ehrwürdigen Ernstes durchaus unabhängig von der Frage, wer eigentlich wen über Jahre hinweg, entgegen aller Vernunft und schlechter Erfahrung, zur Reduzierung von Renten, Sozial- und Gesundheitsleistungen, Anhebung der Mehrwertsteuer, Absenkung der Mindestlöhne und zur Anhebung des Rentenalters erpresst hatte. Das Zitat „Ich habe keinen Bock, ideologische Debatten zu führen mit einer Regierung, die gerade mal zwei Tage im Amt ist“, ließ man dem EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz dann auch ohne mit der Wimper zu zucken, durchgehen. Der Mann ist übrigens genau wie Dijsselbloem Sozialdemokrat. Streng unideologisch unterschlug man seit jeher, dass des einen Schulden des anderen Profite sind.

„Exportweltmeister“ (SPON, natürlich) Deutschland hatte laut der Friedrich-Ebert-Stiftung seit der Einführung der Einheitswährung bis zum Jahr 2009 bereits 600 Milliarden Euro Außenhandelsüberschüsse im Außenhandel generiert. Die deutschen Auslandsforderungen belaufen sich laut Bundesbank inzwischen auf über 1,5 Billionen (!) Euro netto. 100 Milliarden Euro kamen seither aus den südlichen Peripheriestaaten – mehr als in der gleichen Zeit aus den USA. Deutschland profitierte, angefeuert durch Dumpinglöhne der Sorte Hartz IV, wie kein Zweiter vom griechischen Schuldenmachen und haut dem Land nun seine Agenda 2010 quasi als letzten Exportschlager um die Ohren.
Bereits eine zwischen den Jahren 2008 und 2012 erstellte Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Berichterstattung deutscher Leitmedien zum Thema Armut, Reichtum und Eurokrise kam zum vernichtenden Ergebnis, es handele sich hier „um einen Fall von Pressefeigheit. […] Eine Auseinandersetzung mit der Macht privater Großvermögen, die ihre Interessen ohne Worte zur Geltung bringen können, findet nicht statt.“ Insbesondere Zusammenhänge seien kaum erkennbar, wenn das Thema denn überhaupt Erwähnung finde. Am blödesten jedoch hatte sich, wie nicht anders zu erwarten, das pseudokritische Käseblatt aus Hamburg angestellt: „Das Medium beschäftigt sich nach nicht erkennbaren handwerklich-inhaltlichen Kriterien […] punktuell, wenig engagiert und damit unzuverlässig mit dem untersuchten Themenfeld […].“
Geradezu exemplarisch hatte es schwindeln gemacht, als sich Dirk Kurbjuweit im Spiegel 22/2011 auf die Suche nach den Schuldigen der Krise begab: Schuld seien Politiker, die „hilflos“ wirken. „Sie treffen sich in Brüssel, reden, streiten, beschließen, aber nichts wird besser.“ Wie aber ausgerechnet die Politiker beschließen können, dass alles besser wird, erfuhren wir nicht. Schließlich seien „Finanzmärkte“ und „Rating-Agenturen“ „der neue Souverän“, der „gierig und nur an Zahlen interessiert“ sei – und nicht etwa an Nächstenliebe und Armenspeisung. Davon hätte es ohnehin bereits viel zu viel gegeben: Griechisches „Lotterleben“ und „eine Politik, die sich nicht zügeln kann, die ihre Bürger möglichst wenig belasten und möglichst viel beschenken will“, seien „noch nicht die ganze Erklärung.“ Abgesehen davon, dass das Land, genau wie jedes andere in der EU, im Zuge der weltweiten Finanzkrise milliardenschwere Rettungsprogramme für seinen Bankensektor auflegen musste. Gefahr für die Demokratie sei im Verzug: „Junge Menschen entwickeln Utopien, die weit jenseits der bürgerlichen Gesellschaft liegen, weil sie von der nichts mehr erwarten.“ Beim Spiegel begnügte man sich zur Krisenlösung derweil mit „Demut“, „Anstand“ und „Würde“. Dann doch lieber freiwillige Selbstkontrolle im Finanzsektor?

Wie indes Anstand und Würde beim Uni Spiegel aussehen, demonstrierte Sebastian Kempkens, als er im Februar diesen Jahres ergründete, warum der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis unter den Studenten seines Landes derzeit große Beliebtheit genießt. Sind es seine politischen Positionen? Ist es sein akademisches Renommee? Aber nicht doch: „Der Kerl hat alles. Er ist ein genialer Wissenschaftler. Er fährt Motorrad. Er ist lustig und charmant. Er ist einer fürs Bett, man sagt, er sei eine Sexmaschine. Er ist der perfekte Mann“, zitierte die Seite um Seite dämlicher werdende Revolvergazette eine griechische Studentin. Ein linker Finanzminister wie Varoufakis als sexueller Fetisch und Verführer naiver griechischer Mädchen – so lässt sich eine unliebsame Regierung natürlich auch diskreditieren. Denn wo man den zentralen Fragen der ökonomischen und politischen Ordnung Europas intellektuell nicht beikommt bzw. gar nicht beikommen will, hilft nur noch der Skandal, die personalisierte Sexgeschichte der Bildzeitung, abgedruckt im Uni SPIEGEL.
Ist das alles nur Doofheit oder schon Propaganda? Ein Blick in in die Kommentarspalten, frei nach dem Motto „Spiegel-Leser pöbeln mehr“, genügt: „Tsipras, halt dein freches Maul. Wie lange noch belügst du den Rest der Eurozone, weil du glaubst, je abgebrühter, desto besser deine Verhandlungsbasis!“ (27.5). Am Ende ist es das Gleiche.
– Winston Smith
http://lowerclassmag.com/2015/06/im-zweifel-bloed/
1. Juni 2015 nachdenkseiten.de
Die Krise in Griechenland: Kein Mangel an absurden Erklärungsversuchen
Eine Schnellschätzung von Eurostat [PDF – 63,5 KB], dem statistischen Amt der Europäischen Union, ergab in der vorletzten Woche, dass das saisonbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Griechenland im ersten Quartal 2015 im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent gesunken ist. Da die Wirtschaftsleistung des Landes bereits im vierten Quartal 2014 um 0,4 Prozent geschrumpft war, befindet sich Griechenland nach einer gängigen Definition damit wieder in einer Rezession (zwei Minus-Quartale in Folge). Von Günther Grunert[*].
Dabei hatten Politik und Medien hierzulande noch Mitte November letzten Jahres die angebliche wirtschaftliche Wende in Griechenland gefeiert: Damals waren gerade von Eurostat die neuesten Wachstumsraten des BIP für das dritte Quartal 2014 publiziert worden, nach denen Griechenland (zusammen mit Slowenien) mit einem realen BIP-Wachstum von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal die Spitzenposition im Euroraum einnahm.[1] Entsprechend groß war der Jubel: Vom „Wachstumschampion der Eurozone“ (Spiegel online), vom „Überraschungssieger“ Griechenland (Deutschlandfunk) und davon, dass sich die Reformen nun auszahlten, war die Rede. Andreas Scheuerle von der Dekabank glaubte gar einen allgemeinen Trend zu erkennen: „Die Länder, die in Europa Reformen vorangebracht haben, die zeichnen sich jetzt durch hohe Wachstumsraten aus. Und das ist schon einmal eine ganz gute Botschaft“ (Deutschlandfunk).
Seit sich die wirtschaftliche Lage Griechenlands im letzten Quartal 2014 wieder verschlechtert hat, ist auch das Lob für die „vorangebrachten Reformen“ verstummt. Nun wird wieder das genaue Gegenteil behauptet, nämlich, dass wirkliche Reformen in Griechenland bislang noch gar nicht stattgefunden hätten. So kritisiert etwa Jens Weidmann, der Präsident der Deutschen Bundesbank, die Reformbemühungen Griechenlands als unzureichend, und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel schreckt laut Spiegel online bei seiner Mahnung an Griechenland, nun endlich aktiv zu werden, selbst vor einer versteckten Drohung nicht zurück: „Ein drittes Hilfspaket für Athen ist nur möglich, wenn die Reformen auch umgesetzt werden“. Sehr beliebt ist in diesem Zusammenhang bei deutschen Politikern aller Parteien (außer vielleicht der Linken) die Aufforderung an die angeblich reformunwilligen Griechen, statt zu lamentieren erst einmal ihre „Hausaufgaben zu machen“ (vgl. z.B. hier, hier, hier oder hier). Offenbar ist noch niemandem aufgefallen, wie sehr gerade dieser herablassende und dumme Spruch, der wie die Zurechtweisung eines uneinsichtigen Schülers klingt, dazu beiträgt, das Bild des deutschen Oberlehrers in der Eurozone zu festigen.
Und selbstverständlich ist an dem erneuten Einbruch der griechischen Wirtschaft die Regierung Tsipras schuld, auch wenn sie sich erst seit Ende Januar 2015 im Amt befindet, das Negativwachstum aber schon im vierten Quartal 2014 begonnen hat. So behauptet etwa Christian Schulz vom Bankhaus Berenberg laut finanzen.net: „Wie erwartet hat der desaströse Start der griechischen Regierung das Land von einer beginnenden Erholung zurück in die Rezession geführt“ (ähnlich die Welt vom 8. 4. 2015: „So würgt Tsipras den griechischen Aufschwung ab“).
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nimmt demgegenüber zumindest zur Kenntnis, dass der offizielle Rückfall der griechischen Wirtschaft in die Rezession schon Monate vor dem Amtsantritt der von Syriza geführten Regierung begonnen hat. Aber das ändert seiner Meinung nach nichts an der Verantwortung der Regierung Tsipras: Bis zum Herbst des letzten Jahres – so Schäuble – habe sich die Wirtschaft Griechenlands besser entwickelt, als dies von allen Experten vorhergesehen worden sei. „Die neue Regierung hat dann im Wahlkampf und nach der Wahl alle guten Zahlen zerstört“, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Finanzminister. So ist sie, diese Syriza: Bevor sie überhaupt an der Regierung ist, hat sie die griechische Wirtschaft bereits in den Ruin getrieben, allein durch ihren Wahlkampf!
Man muss einen solchen Unsinn nicht kommentieren; er kommentiert sich selbst. Aber auch die anderen, oben genannten „Argumente“ erweisen sich bei genauerer Betrachtung als substanzlos. Das gilt zunächst für die Behauptung Schäubles und vieler anderer, die griechische Wirtschaft habe sich vor ihrem Einbruch im vierten Quartal 2014 in einem stabilen Aufschwung befunden. Wir haben an anderer Stelle (Grunert 2015) schon zu Anfang dieses Jahres darauf hingewiesen – und vorher schon der australische Ökonom Bill Mitchell (2014) – , dass das vielumjubelte reale Wachstum Griechenlands im dritten Quartal 2014 vermutlich primär darauf zurückzuführen ist, dass in Griechenland zu dieser Zeit die Preise bereits schneller sanken als die Einkommen[2] (vgl. dazu auch Spiegel online vom 13.1.2015). Die griechische Wirtschaft befand sich also in einer offenen Deflation und nicht etwa am Beginn einer dynamischen und nachhaltigen Aufwärtsbewegung. Die Erfolge der „Reformpolitik“, der „gute Weg“, auf dem sich Griechenland nach Schäubles Ansicht im letzten Jahr bereits befand, sind mithin reine Illusion.
Kaum noch nachvollziehbar ist darüber hinaus die Behauptung, die Probleme Griechenlands resultierten daraus, dass die griechische Regierung „keinen entschlossenen Reformkurs“ (so auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in der Süddeutschen Zeitung) fahre. So zeigt etwa eine neue Studie von Giannitsis/Zografakis, dass in Griechenland zwischen 2008 und 2012 die gesamten zu versteuernden Einkommen aller Haushalte um 22,6 Prozent, die gesamten Lohneinkommen gar um 27,4 Prozent gesunken sind (Giannitsis/Zografakis 2015, S. 24ff). Letzteres ist zu einem wesentlichen Teil eine Folge der radikalen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in Griechenland, die u.a. mit einer Lockerung des Kündigungsschutzes, einer Senkung des Mindestlohns im Privatsektor um 22 Prozent, einer Schwächung der Tarifvertragsstrukturen und einer Reduzierung der Abfindungen einherging.
Die Zahl der im öffentlichen Sektor beschäftigten Arbeitnehmer ist seit 2009 – je nach Abgrenzung – zwischen 20 Prozent und über 30 Prozent verringert worden[3], zusätzlich kam es seit 2010 zu deutlichen jährlichen Budgetkürzungen im öffentlichen Bildungs- und Gesundheitswesen, im Transportwesen und bei den staatlichen Sozialleistungen. Viele Vermögenswerte in Staatsbesitz sind mittlerweile privatisiert worden (Polychroniou 2015). Nach einer erst jüngst erschienenen Analyse der konservativen Industrieländerorganisation OECD, die mit Hilfe eines „Reform Responsiveness“-Indikators (zur Berechnung vgl. OECD 2015, S. 106) die Reformintensität insgesamt in den OECD-Ländern im Zeitraum 2007 bis 2014 vergleicht, weist Griechenland die höchste Reformaktivität aller in die Untersuchung einbezogenen 30 Länder aus und liegt damit weit vor Deutschland, das abgeschlagen auf dem vierundzwanzigsten Platz rangiert (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Reformintensität insgesamt im Zeitraum 2007 bis 2014
Quelle: OECD 2015, S. 109
Wenn es wirklich stimmte, dass die Reformtätigkeit in einem Land sein Wirtschaftswachstum maßgeblich positiv beeinflusst, hätte Griechenland ein wahres Wachstumswunder erleben müssen. In jedem Fall aber geht die Behauptung, die Reformbereitschaft in Griechenland sei unzureichend und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes seien darauf zurückzuführen, dass es sich weigere, seine „Hausaufgaben zu machen“, komplett an der Realität vorbei.
Dabei sind die Wachstumszahlen Griechenlands eigentlich sehr einfach zu interpretieren, wenn man die ideologischen Scheuklappen ablegt (vgl. zum Folgenden auch Flassbeck 2015a, 2015b). Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, verzeichnete Griechenland von Anfang 1995 bis zum globalen Einbruch im Zuge der „großen Rezession“, die im Jahr 2008 begann, eine durchaus erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung – trotz der Vielzahl vermeintlicher struktureller Hemmnisse (zu denen oft auch Steuerhinterziehung und Korruption gezählt werden), die ja nicht schlagartig erst mit Beginn der Finanzkrise aufgetreten sind.
Abbildung 2: Vierteljährliche Wachstumsrate des realen BIP in Griechenland – Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorquartal

Quelle: Mitchell 2015
Anders als etwa Deutschland reagierte Griechenland, das bereits ein großes staatliches Budgetdefizit, einen hohen öffentlichen Schuldenstand und hohe Leistungsbilanzdefizite aufwies, nicht mit staatlichen Konjunkturprogrammen auf den massiven wirtschaftlichen Einbruch und geriet immer tiefer in die Krise und immer mehr unter den Druck der Finanzmärkte, an denen die Anleger schließlich prohibitiv hohe Zinssätze von Athen verlangten.[4]
Dann kam die „Rettung“ durch die Troika in Form von Hilfsprogrammen (das erste Programm im Mai 2010) – verknüpft mit rigiden Sparauflagen, die wesentlich auf Bestreben der deutschen Bundesregierung zustande kamen. Diese ökonomisch widersinnigen Auflagen für die Hilfsgelder stürzten die bereits durch die globale Finanzkrise angeschlagene griechische Wirtschaft in die Katastrophe. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, sank das reale BIP in Griechenland ab Mitte 2009 18 Quartale hintereinander (wie oben erwähnt, befindet sich ein Land nach einer gängigen Definition bereits in der Rezession, wenn seine Wirtschafsleistung nur zwei Quartale in Folge rückläufig ist). Das reale BIP ist damit heute um rund ein Viertel niedriger als bei seinem Höchststand vor Rezessionsbeginn im Jahre 2008.
Der Umfang des ökonomischen Niedergangs und die Folgen für die Zukunft Griechenlands zeigen sich noch deutlicher am Arbeitsmarkt (dazu ausführlicher Antonopoulos et al. 2015). So sank die Gesamtzahl der Beschäftigten in Griechenland von 2008 bis zum dritten Quartal 2014 um mehr als eine Million. Dies entspricht einem Rückgang von rund 23 Prozent.[5] Das Tempo der Arbeitsplatzverluste erhöhte sich dabei mit Beginn der Austeritätsjahre: Rund 77 Prozent des Beschäftigungsrückgangs entfallen auf den Zeitraum 2010 bis 2014 (vgl. auch Abbildung 3).
Abbildung 3: Gesamtbeschäftigung in Griechenland, 1998 bis 2014

Quelle: Antonopoulos et al. 2015, S.6
Zwar fiel die Zahl der Arbeitslosen in Griechenland zuletzt leicht von 1,32 Millionen im dritten Quartal 2013 auf 1,23 Millionen im gleichen Quartal 2014 (nachdem sie im Jahr 2008 im selben Zeitraum nur knapp 364 000 betragen hatte), aber der Anteil der Langzeitarbeitslosen, d.h. der Anteil derjenigen, die seit vier oder mehr Jahren ohne Job sind, stieg von 18,2 auf 25,1 Prozent (Antonopoulos et al. 2015, S. 10). Das ist eine fatale Entwicklung, da sich bei fortdauernder Langzeitarbeitslosigkeit für die Betroffenen die Chancen auf Wiedereinstellung aufgrund von Qualifikationsverlusten und negativer Signale an potenzielle Arbeitgeber immer mehr verringern.
Bedenkt man darüber hinaus, dass die Jugendarbeitslosenquote in Griechenland immer noch bei über 50 Prozent liegt, also ein Großteil der Jugend vom Erwerb von Qualifikationen, Fertigkeiten, Erfahrungen und Arbeitseinstellungen für eine erfolgreiche spätere Berufstätigkeit ausgeschlossen ist, und dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 – 74 Jahre) – nach einem Höchststand von 8,48 Millionen im vierten Quartal 2007 – seit Beginn der Krise wegen mangelnder Arbeitskräftenachfrage und daraus resultierender Emigration gerade qualifizierter griechischer Arbeitskräfte kontinuierlich um 0,5 bis 1 Prozentpunkte pro Jahr abnimmt (Antonopoulos et al. 2015, S. 5), so offenbart sich das ganze Ausmaß des ökonomischen und menschlichen Desasters, das die verfehlte Austeritätspolitik in Griechenland angerichtet hat und dessen Folgen dort noch jahrzehntelang spürbar sein werden.
Literatur
- Antonopoulos, R./Adam, S./Kim, K./Masterson, T./Papadimitriou, D.B. (2015): Responding to the Unemployment Challenge: A Job Guarantee Proposal for Greece – An Addendum [PDF – 734 KB], Research Project Report, May, Levy Economics Institute; letzter Zugriff: 27.05.2015
- Flassbeck, H. (2015a): Der “gute Weg” Griechenlands, die Troika und die Zukunft der EWU, flassbeck-economics; letzter Zugriff: 27.05.2015
- Flassbeck, H. (2015b): Griechenland-Bashing 2.0 – wieder wird manipuliert, allerdings ein wenig feiner, flassbeck economics; letzter Zugriff: 27.05.2015
- Giannitsis, T./Zografakis, S. (2015): Greece: Solidarity and Adjustment in Times of Crisis [PDF – 2.1 MB], IMK Study 38, letzter Zugriff: 27.05.2015
- Grunert, G. (2015): Griechenland: Als Wachstumssieger zurück in die Krise?, flassbeck-economics; letzter Zugriff: 27.05.2015
- Mitchell, B. (2014): Alleged Greek growth could be an illusion; letzter Zugriff: 27.05.2015
- Mitchell, B. (2015): Friday lay day – Greece back in recession but austerity works doesn’t it?; letzter Zugriff: 27.05.2015
- OECD (2015): Economic Policy Reforms 2015 – Going for Growth, Paris
- Polychroniou, C.J. (2015): Greece’s overtures to Russia may not be a sideshow, Al Jazeera; letzter Zugriff: 27.05.2015
[«*] Grunert, Günther, Dr., geb. 1955, ist an den Berufsbildenden Schulen der Stadt Osnabrück am Pottgraben vor allem im Bereich Berufs- und Fachoberschule Wirtschaft tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Makroökonomie, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Arbeitsmarkt.
[«1] Nach den revidierten Daten von Mai 2015 liegt Griechenland im dritten Quartal 2014 allerdings nur noch auf dem dritten Platz in der Liste der wachstumsstärksten Euroländer.
[«2] Etwas genauer: Für die Wachstumsraten g (= prozentuale Änderung) gilt näherungsweise: g BIPr = g BIPn – g P. Dies heißt, dass die Wachstumsrate des realen BIP (g BIPr) ungefähr (nicht mathematisch exakt, aber das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle) der Differenz zwischen der Wachstumsrate des nominalen BIP (g BIPn) und der Wachstumsrate des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus (g P), also der Inflationsrate, entspricht. Beträgt also beispielsweise in einer Volkswirtschaft die Wachstumsrate des nominalen BIP -2 Prozent, die Inflationsrate gleichzeitig -3 Prozent (herrscht also Deflation vor), so ist die Wachstumsrate des realen BIP = +1 Prozent: 1 = -2 – (-3).
[«3] Anders als oft behauptet war der öffentliche Sektor in Griechenland nie überdimensioniert; vielmehr unterschied sich seine Größe nicht wesentlich von der in anderen EU-Ländern. So betrug nach Daten der ILO (International Labour Organization) in Griechenland im Jahr 2010 der Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Sektor an der Gesamtzahl der Beschäftigten 22,3 Prozent. Die entsprechenden Vergleichswerte für z.B. Frankreich und das Vereinigte Königreich lagen bei 20 resp. 25,1 Prozent (Antonopoulos et al. 2015, S.6).
[«4] Ein souveräner Staat, der seine eigene Währung emittiert (also etwa der Staat der USA), kann stets seinen in dieser Währung denominierten Verbindlichkeiten nachkommen und deshalb nicht pleitegehen. Anders sieht es bei Griechenland aus, das mit dem Eintritt in die Eurozone seine Währungssouveränität aufgegeben hat und stattdessen eine Fremdwährung (den Euro) verwendet. Der griechische Staat ist damit ebenso wie die Staaten aller anderen Euroländer dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit ausgesetzt. Zu viele Schulden schrecken die Finanzmärkte auf und führen zu steigenden Risikoaufschlägen für die Anleihen der betroffenen Staaten. Letztendlich hätte die Befreiung Griechenlands und der anderen Euro-Krisenländer aus ihrer wirtschaftlichen Notlage eine radikale Änderung der Fiskal- und vor allem der Lohnpolitik in den übrigen Euroländern (und hier insbesondere in Deutschland) sowie eine stärkere Unterstützung durch die Europäische Zentralbank (sofortige Ankündigung eines notfalls unbegrenzten Ankaufs von Staatsanleihen Griechenlands und der anderen Krisenländer, um damit den desaströsen, gänzlich verselbstständigten Zinsanstieg zu stoppen) erfordert. Dies blieb jedoch aus.
[«5] Berechnet als der Unterschied zwischen der (Jahres-) Beschäftigung 2008 und der durchschnittlichen Beschäftigung von Januar bis September 2014 (nach ELSTAT, der griechischen Statistikbehörde).
http://www.nachdenkseiten.de/?p=26287
18. Juni 2015 nachdenkseiten.de
Es reicht! – Die Grexit-Kampagne der Bild-Zeitung
Verantwortlich: Wolfgang Lieb
„Frau Bundeskanzlerin, diese Rede wollen wir von Ihnen hören“ unter dieser Überschrift veröffentlichte die Bild-Zeitung gestern einen Entwurf einer Regierungserklärung für Angela Merkel. Bild schreibt der Kanzlerin darin vor, was sie sagen müsste. Die klare Botschaft an die griechische Regierung lautet: „Es reicht!“. In diesem Beitrag finden sich geballt die Behauptungen, Halbwahrheiten und Lügen mit der die Bild-Zeitung seit Jahren gegen „die Griechen“ und zuletzt vor allem gegen die neue griechische Regierung hetzte. Wir haben Niels Kadritzke gebeten, diese Behauptungen einmal unter die Lupe zu nehmen.
- Behauptung
„Fünf Jahre lang haben wir dafür gearbeitet, dafür gerungen, dass Griechenland Teil der Euro-Familie bleibt.
Fünf Jahre haben wir dafür gekämpft, Griechenland vor der Staatspleite zu retten.
Dafür hat Deutschland allein 87 Milliarden direkte Garantien und Notenbank-Kredite bereitgestellt.
Wir sind bis an die Grenzen des Leistbaren gegangen und manchmal auch darüber hinaus.“
Niels Kadritzke: Das ist schon zum Auftakt eine wunderbare Pointe: Die Redaktion der Zeitung, die unserer Bundeskanzlerin das Bekenntnis in den Mund legt, fünf Jahre lang für den Verbleib Griechenlands in der „Euro-Familie“ gekämpft zu haben, tut seit fünf Jahren nichts anderes, als ihren Lesern einzureden, dass dieses Land in der Eurozone nichts zu suchen hat. Zu Beginn der Krise schickte BILD einen Reporter los, der auf Athens Straßen versuchte, den Passanten alte Drachmen-Scheinen aufzudrängen und damit auf den Grexit einzustimmen (zu seiner Enttäuschung wollten die Leute von der Drachme nichts wissen). Es folgte eine Kaskade von Berichten, angeblichen Reportagen, Aufrufen an Bundestagsabgeordnete, die stets das eine Ziel hatten: den Rausschmiss Griechenlands aus der Eurozone zu propagieren.
Der gestern publizierten Grexit-Rede, mit der sich die Redaktion als Ghostwriter für die Kanzlerin anbietet, ging ein Coup der besonderen Art voraus: Im März interviewte BILD den Chefideologen der Grexit-Fraktion innerhalb der Syriza, Kostas Lapavitsas. Der in England ausgebildete und heute im Athener Parlament sitzende Ökonom wurde zur gezielten Desinformation der Leser als „einer der wichtigsten Berater von Alexis Tsipras“ vorgestellt. In Wirklichkeit ist Lapavitsas, der die „Linke Plattform“ innerhalb der Syriza repräsentiert, der entschiedenste innerparteiliche Widersacher von Tspipras und Varoufakis in der Grexit/Drachmen-Frage. Was man natürlich auch in der BILD-Redaktion weiß.
„Bis an die Grenzen des Leistbaren?“
Wenn heute laut Umfragen eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger für den Grexit ist, muss man diese Umfrage-Zahlen auch als Belohnung für die publizistische-propagandistische Leistung des deutschen Zentralorgans der Grexit-Betreiber sehen. Aber was erzählen die angemaßten Merkel-Ghostwriter ihren Lesern. Sehen wir etwas genauer hin: Es fängt gleich mit einer faustdicken Desinformation an: dass Deutschland in selbstloser Solidarität mit Griechenland „bis an die Grenzen des Leistbaren“ gegangen sei, „und manchmal auch darüber hinaus“.
„Grenze des Leistbaren“? Lassen wir an dieser Stelle mal beiseite, an welche Grenzen des Leistbaren sich heute, im sechsten Jahr der Krise und der „Rettungsprogramme“, die große Mehrheit der Griechen befindet (die Zahlen sprechen für sich: eine um mehr als 25 Prozent geschrumpftes Wirtschaft; eine Arbeitslosenquote, die immer noch bei 26 Prozent liegt und im letzten Quartal wieder leicht angestiegen ist; fast eine Million Langzeitarbeitslose ohne jedes Einkommen; zwei Millionen Menschen ohne jegliche Krankenversicherung).
Hier geht es um den Teil der deutschen „Leistungsbilanz“, die BILD seinen Lesern vorenthält: um die „geldwerten Vorteile“, die Deutschland aus der griechischen Katastrophe erzielen konnte.
- Deutschland zahlt seit Beginn der Eurokrise einmalig niedrige Zinsen für seine eigenen Staatspapiere: die 10-Jahres-Bundesanleihen finanzieren einen Teil unserer Staatsausgaben praktisch durch zinslose Kredite. Die Ersparnis der öffentlichen Hand seit 2010 wird auf 60 bis 80 Milliarden Euro geschätzt. Die Null-Verschuldung des deutschen Staates ist also teilweise ein Resultat der großzügigen Rettungsprogramme.
- Der Exportweltmeister Deutschland profitiert ganz besonders stark vom Fall des Euro-Preises, der eine unmittelbare Folge der Krise des europäischen Südens ist.
- Den vielleicht bedeutendsten Kollateralnutzen hat die deutsche Volkswirtschaft dank des Imports junger, gut qualifizierter Arbeitskräfte aus den Krisenländern, die in ihrer Heimat keine Perspektive haben. Fachkräfte fehlen (z.B. Mediziner); das bedeutet einen Transfer von wertvollem Knowhow, ohne dass unsere Gesellschaft für die entsprechende Ausbildung gezahlt hätte.
Und diese Liste der Krisengewinne ist längst noch nicht vollständig.
Richtig ist, und das hat eine deutsche Regierung ihren Bürgern auch zu erklären, dass ein Schuldenschnitt – auch in Form verminderter Zinsen und längerer Rückzahlungsfristen für die Griechenland-Kredite aus dem bail-out-Progamm – erstmals auch den deutschen Steuerzahler belasten würden (wenn auch weit weniger als die nackten Zahlen besagen). Aber hier wäre eine Rechnung aufzumachen, die BILD seinen Lesern verschweigt: auf jedem Fall würden diese deutschen „Krisenverluste“ deutlich unter den bislang erzielten Krisengewinnen liegen.
- Behauptung:
Nach der BILD-Merkel hält die neue griechische Regierung nicht, was sie verspricht: „Weder wurden Betriebe privatisiert, noch wurde ein funktionierendes Steuersystem in Gang gesetzt“.
Niels Kadritzke: Zu dieser Behauptung sind zwei Anmerkungen fällig:
Zum einen wird der neuen Regierung der Wortbruch ihrer Vorgänger-Regierungen in die Schuhe geschoben, die in der Tat das Steuersystem nicht oder nur zögerlich reformiert und nur wenig gegen die Steuerhinterziehung getan haben. Zwar hätte auch die Regierung Tsipras in den ersten Monaten ihrer Amtszeit mehr tun können (und ohne eine Vereinbarung mit den Gläubiger-Institutionen abzuwarten), aber ihr Interesse am Kampf gegen die Steuersünder ist deutlicher ausgeprägter als das der abgewählten Regierung Samaras. Allerdings hat sie einige sehr problematische gesetzliche Regelungen erlassen, die auf eine allzu milde Amnestie von Steuersündern gleichkommen. Dieses falsche Signal an die Steuersünder ist allerdings zum Teil auf den Druck zurückzuführen, den die Gläubiger ausüben: Um den verarmten Schichten weitere soziale Einschnitte zu ersparen, will die Regierung Tsipras möglichst schnell die ausstehende Steuerschulden eintreiben. Damit gewinnt das Ziel der Haushaltssanierung eine fatale Priorität auf Kosten langfristig tragfähiger Lösungen.
Die zweite Anmerkung betrifft die Privatisierungen. Auch hier ist schon die alte Regierung weit hinter den gesteckten bzw. auferlegten Zielen zurückgeblieben, weil diese schlicht illusionär waren. Die wenigen bislang durchgezogenen Privatisierungen (die lediglich etwas über 3 Milliarden Euro in die Staatskasse brachten) liefen eher auf einen billigen Ausverkauf hinaus, weil nur Krisentiefstpreise erzielt werden konnten. Zudem hat der Staat, etwa beim (Aus)Verkauf der staatlichen Lotto-Gesellschaft, auf sehr viel höhere laufende Staatseinnahmen verzichtet. Angesichts dieser negativen Erfahrungen verhält sich die Regierung Tsipras völlig rational. Sie lehnt Privatisierungen nicht grundsätzlich ab, besteht aber auf zwei Bedingungen:
- die öffentliche Hand soll einen Mindestanteil an dem privatisierten Unternehmen behalten, um bei der Geschäftspolitik mitreden zu können,
- die privaten Käufer sollen verbindlich auf Investitionen verpflichtet werden, die einen Beitrag zur Erholung der Wirtschaft leisten können.
- Behauptung
„Griechenlands Schuldenpolitik ist unsolidarisch. Ein Beispiel: Um zu sparen, hat Italien die Frührente für Mütter abgeschafft. Nur in Griechenland gibt es sie noch. Alle müssen dafür zahlen, auch Italien.
Aber es kann doch nicht sein, dass wir in Europa sparen und reformieren – und nur Griechenland macht weiter, als wäre nichts geschehen!
Und dann das Renteneintrittsalter: Wer 56 Jahre alt ist und im öffentlichen Dienst in Griechenland arbeitet, der kann vorzeitig in Rente gehen.
Zahlen für diese Sozialmaßnahmen muss der Rest der EU!“
Niels Kadritzke: Griechenlands Schuldenpolitik war in der Tat unsolidarisch, weil sie die Lasten der Krise fundamental ungerecht verteilt. Beleg dafür ist, dass sich die Ungleichheit in der Krise noch weiter verschärft hat.
Aber das meint die BILD-Kanzlerin nicht. Sie spielt vielmehr „die Griechen“ gegen „die Italiener“ und andere Südländer aus. Was schon deshalb demagogisch ist, weil kein Land der Eurozone eine auch nur annähernde vergleichbare Reduktion der Masseneinkommen (um 35 bis 40 Prozent) aufweist wie Griechenland. Wobei die Einbußen am verfügbaren Einkommen noch höher liegen, weil die steuerliche Belastung selbst der ärmsten Schichten erheblich angestiegen ist. Dies gilt auch für die Rentenbezüge, die im Durchschnitt so niedrig liegen, dass fast 45 Prozent aller Rentner inzwischen als „armutsgefährdet“ einzustufen sind, weil ihr verfügbares Einkommen weniger als 60 Prozent der Medianeinkommen beträgt.
Dennoch will BILD die „unsolidarischen“ Griechen wieder einmal mit Verweis auf das Rentensystem „überführen“. Die Ebene ist allerdings nicht ungeschickt gewählt: Kein Mensch kann bezweifeln, dass das griechische Rentensystem vor der Krise einer der Ursachen für die hohen Defizite war, die in den Sozialkassen und damit im Staatshaushalt aufgelaufen sind. Das weiß heute nicht zuletzt die Regierung Tsipras, die erkannt hat, dass der hohe Anteil von Frühverrentungen im öffentlichen Sektor der entscheidende Faktor ist, die das Rentensystem an den Abgrund gebracht hat.
Aber nach klassischer Bild-Methode sind die pauschalen Behauptungen im Detail falsch und im Ganzen irreführend.[*] Unsinn ist vor allem die Behauptung, dass „der Rest der EU“ für griechische „Sozialmaßnahmen“ zahlen muss. Im Gegenteil: für die noch bestehenden Ungerechtigkeiten – vor allem im Hinblick auf Frührenten – zahlen allein die Ärmsten der armen Griechen, weil das Sozialsystem zum Beispiel keinerlei Vorsorge für Langzeitarbeitslose kennt, deren einzige Überlebenshilfe häufig die Rente des Ehepartners oder gar der Eltern oder Großeltern darstellt.
Nun aber zu den Detail der Merkel-Rede von Bild:
Die pauschale Rede von einer „Frührente für Mütter“ ist grob irreführend. Es gab und gibt sie nur für Mütter, die beim Eintritt ins (vorgezogene) Rentenalter noch schulpflichtige Kinder haben. Für die überwiegende Mehrheit der weiblichen Erwerbstätigen trifft dieses Kriterium nicht zu, weil ihre Kinder beim Erreichen des Rentenalters bereits erwachsen sind.
Vor der Krise konnten öffentliche Bedienstete tatsächlich mit 56 Jahren in Frührente gehen; diese niedrige Grenze wird aber schrittweise erhöht, bis sie (in zehn Jahren) bei 62 Jahren liegen soll, während das reguläre Rentenalter auf 67 Jahre angehoben wird. Gerade in diesem Punkt hat die neue griechische Regierung eingesehen, dass das alte System nicht mehr finanzierbar ist. Aber sie hat auch kapiert, dass die von der Troika geforderte zügige „Verschlankung“ des öffentlichen Dienstes, die seit 2009 über eine Welle von Anträgen auf Frührenten erfolgte, die Rentenkassen an den Rand des Abgrunds geführt hat.
Genau diese Erfahrung ist der Grund dafür, dass es in einem wichtigen Detail – trotz der Übereinstimmung in der Grundsatzfrage – gewichtige Differenz zwischen Athen und den „Institutionen“ der alten Troika gibt. Letztere, und vor allem der IWF, wollen die Griechen zwingen, die Altersgrenze für Frühverrentung sofort (also spätestens Anfang 2016) und mit einem Schlag auf 62 Jahre anzuheben. Das aber hätte zur Folge, dass in den kommenden Wochen und Monaten Zehntausende Bedienstete des öffentlichen Sektors (öffentlicher Dienst wie öffentliche Unternehmen, aber auch halbstaatliche Banken) noch schnell nach den alten Bedingungen ihre Frührente beantragen würden. Das würde die Kassen schlagartig überlasten und unverzüglich in den Bankrott stürzen, den eine mittel- und langfristige Reform ja gerade abwenden soll.
Dies ist ein klassisches Beispiel für irrationale und kontraproduktive Forderungen der Gläubiger. Und die Regierung Tsipras hat in der Sache völlig Recht, wenn sie ein so wichtiges strukturelles Problem wie die langfristige Sanierung der Kassen auf eine spätere Verhandlungsphase verschieben will.
- Behauptung:
„Griechenlands politische Führung ist dabei, dem Ansehen der Europäischen Union viel Schaden zuzufügen. Wir müssen aufpassen, dass die Bürger sich nicht von Europa abwenden.
Sigmar Gabriel hat ausgesprochen, was viele denken: „Wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen.“
Der nationale Weg, den Griechenland geht, bedeutet in letzter Konsequenz, dass es nicht mehr Teil der Euro-Familie sein will und auch nicht mehr bleiben kann.
Meine Damen und Herren; Griechenland gilt wegen seiner Geschichte zu Recht als Wiege Europas. Und auch mit dem Austritt aus dem Euro-Raum bleibt das Land ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Geben wir Griechenland die Zeit, sich selbst zu erneuern.
Für seine Menschen und für Europa.“
Damit ist der Gipfel der Demagogie erreicht: Die Bundesregierung, repräsentiert durch desinformierte und desinformierende Bild-Redakteure, kennt die Interessen der griechischen Bevölkerung besser als diese selbst. Wenn sich ein Boulevard-Blatt zum Sprachrohr der deutschen Bevölkerungsmehrheit macht, die die Griechen aus dem Euroraum verstoßen will, darf man sich nicht groß wundern. Aber wenn es sich als Anwalt der armen Griechen aufspielt, macht das nur noch sprachlos.
BILD klärt also nicht nur die deutsche Gesellschaft auf, sondern auch die griechische, die noch gar nicht kapiert hat, dass sie „nicht mehr Teil der Euro-Familie sein will“. Obwohl regelmäßig drei von vier Griechen (nach der neusten Umfrage knapp 70 Prozent) unbedingt in der Eurozone bleiben wollen.
Aber auf ein Detail muss hier noch verwiesen werden: auf die Tatsache, dass sich das Springer-Blatt bei dem zynischen Plädoyer für den Rausschmiss Griechenlands bei Vizekanzler Gabriel bedienen kann. Damit wird offenbar, dass die Führung der Sozialdemokratie, verzweifelt über ihre eigenen Umfragewerte, auf dem Niveau der rechtspopulistischen Propaganda angekommen ist: Die „deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien“ wollen nicht für „überzogene“ Wahlversprechen von Kommunisten zahlen?
Dieser Bezug auf „die Kommunsten“ ist von hochgradiger Ironie. Es ist zwar richtig, dass es innerhalb der Syriza bekennende Kommunisten (aller Schattierungen) gibt, die auch innerhalb der Parteigremien und in der Parlamentsfraktion ziemlich stark repräsentiert sind. Aber das Bemerkenswerte liegt hier darin, dass Gabriel und die BILD-Redaktion dabei sind, die Erwartungen und Hoffnungen des linken Syriza-Flügels zu erfüllen, der ganz offen für den Grexit eintritt. Kostas Lapavitsas durfte also seine Botschaft über die BILD-Zeitung transportieren. Er und die Grexit-Fraktion innerhalb der Syriza argumentieren heute auf derselben Linie wie die Euro-Fighter von der AfD und neoliberale Einzelkämpfern wie Hans-Olaf Henkel. Ob Kommunisten oder nicht – als Mitstreiter in einer deutschen Grexit-Kampagne sind sie durchaus willkommen. (Siehe dazu meine Analyse über den Grexit in der letzten Ausgabe der Le Monde diplomatique).
[«*] Nach einem Bericht des Athener Arbeits- und Sozialministeriums aus dem Februar müssen in Griechenland 20 Prozent der Bürger mit bis zu 500 Euro im Monat auskommen, 38 Prozent erhalten 500 bis 1000 Euro ausgezahlt. 23 Prozent stehen mit 1000 bis 1500 Euro deutlich besser da. Und 17 Prozent beziehen mehr als 1500 Euro.
- Siehe auch: Das griechische Renteneintrittsalter liegt nicht bei 56 Jahren
- Siehe Überblick über das Rentenalter in den 27 EU-Staaten
http://www.nachdenkseiten.de/?p=26458
Warum wir den Griechen unseren Dank schulden
Ihre Sturheit hat uns die Augen geöffnet, welche Fehlkonstruktion die EU ist. Alles kann man kündigen, jeden Vertrag, jede Ehe. Aber nicht den Maastricht-Vertrag. Soll er bis ans Ende der Tage gelten?
Friedrich Didier: Europa arbeitet in Deutschland. Sauckel mobilisiert die Leistungsreserven
Published by Zentralverlag der NSDAP Franz Eher Nachf. Berlin (1943)
Die Welt erkennt in der EU keine echte Wertegemeinschaft, höchsten eine Wertegemeinschaft der lupenreinen Hurensöhne (Rackets)
Egal, wie der Kampf um Athen ausgeht, ob die Griechen in der Euro-Zone bleiben oder ihren Austritt erklären, wir sollten den Nachkommen der Hellenen jetzt schon dankbar sein.
Mit ihrem Eigensinn, ihrer Sturheit und Querköpfigkeit haben sie sich selbst möglicherweise keinen Gefallen getan, dafür aber haben sie den Zaungästen am Rande der Arena brutal und radikal klargemacht, was die Europäische Union ihrem Wesen nach ist: keine Wertegemeinschaft, wie von ihren Anhängern immer behauptet wird, sondern ein ideologisches Konstrukt, dessen wichtigste Aufgabe darin besteht, den Selbsterhalt zu sichern, ein Kartenhaus ohne Ausgang, ein Neuschwanstein der Lüfte, dazu geschaffen, den Bauherren zu huldigen und pompöse Feste zu feiern.
Jede Heizdecke, die bei einer Kaffeefahrt gekauft wurde, kann zurückgegeben werden
So haben wir, quasi nebenbei, erfahren, dass ein Land, das den Euro angenommen hat, aus der Euro-Zone gar nicht austreten kann. An diese Möglichkeit haben die Konstrukteure des Euro nicht einmal gedacht, auch nicht daran, dass ein solcher Knebelvertrag schlicht sittenwidrig ist.
Jede Heizdecke, die bei einer Kaffeefahrt gekauft wurde, kann zurückgegeben werden, in Irland werden katholisch geschlossene Ehen von zivilen Gerichten geschieden, der Vatikan annulliert Ehen, die unter Vortäuschung falscher Tatsachen eingegangen wurden.
Homogenisierungswahn made in EU (Raubtiersozialismus – der Verstand schafft sich ab)
Nur der Vertrag von Maastricht, mit dem der Übergang von der EG zur EU und die Einführung einer Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen wurden, soll bis ans Ende aller Tage gelten, wie die Zehn Gebote oder das Kleingedruckte bei der Telekom?
Der EU liegt eine absurde Idee zugrunde: dass man über eine begrenzte politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus die Lebensverhältnisse in den Mitgliedsstaaten homogenisieren kann.
Etwas, das schon innerhalb eines Landes wie Deutschland extrem schwierig ist, wo es nicht einmal gelingt, die Ferienzeiten in den einzelnen Bundesländern so abzustimmen, dass ein Verkehrschaos vermieden wird, soll innerhalb eines komplexen und vielfältigen Gebildes funktionieren, von Estland bis Portugal, von Finnland bis Griechenland.
Kein Mensch käme je auf die Idee, ein Autorennen zu veranstalten, an dem alle Typen von Rennautos teilnehmen sollten, vom Gokart bis zur Formel-1-Rakete
Das wichtigste Instrument dieser Homogenisierung ist der Euro, der wirtschaftliche Unterschiede ausgleichen soll – Arbeitslosigkeit in einem Land, Vollbeschäftigung in einem anderen. Positive Handelsbilanz hier, negative gleich nebenan. (…)
Nur der Vertrag von Maastricht, mit dem der Übergang von der EG zur EU und die Einführung einer Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen wurden, soll bis ans Ende aller Tage gelten, wie die Zehn Gebote oder das Kleingedruckte bei der Telekom?
Der EU liegt eine absurde Idee zugrunde: dass man über eine begrenzte politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus die Lebensverhältnisse in den Mitgliedsstaaten homogenisieren kann.
Etwas, das schon innerhalb eines Landes wie Deutschland extrem schwierig ist, wo es nicht einmal gelingt, die Ferienzeiten in den einzelnen Bundesländern so abzustimmen, dass ein Verkehrschaos vermieden wird, soll innerhalb eines komplexen und vielfältigen Gebildes funktionieren, von Estland bis Portugal, von Finnland bis Griechenland.
Kein Mensch käme je auf die Idee, ein Autorennen zu veranstalten, an dem alle Typen von Rennautos teilnehmen sollten, vom Gokart bis zur Formel-1-Rakete
Das wichtigste Instrument dieser Homogenisierung ist der Euro, der wirtschaftliche Unterschiede ausgleichen soll – Arbeitslosigkeit in einem Land, Vollbeschäftigung in einem anderen. Positive Handelsbilanz hier, negative gleich nebenan.
Was würde Woody Allen zu dieser Ehe sagen?
Kein Mensch freilich käme je auf die Idee, ein Autorennen zu veranstalten, an dem alle Typen von Rennautos teilnehmen sollten, vom Gokart bis zur Formel-1-Rakete. Das Ergebnis wäre absehbar, nur die Veranstalter würden so ein Rennen als einen „Sieg der Chancengleichheit“ bejubeln.
Innerhalb der EU hat diese Art der „Chancengleichheit“ dazu geführt, dass es „im Süden Europas eine Situation gibt, die der großen Depression der Weltwirtschaftskrise ähnelt“. Das sagt der Ökonom Max Otte, der im Jahre 2006 die Finanzkrise vorhergesagt hat und dafür ausgelacht wurde.
Das Lachen hielt nicht lange an, 2008 war die Krise da. Und sieben Jahre später ist die EU noch immer damit beschäftigt, die Krise zu managen. Mehr noch, die Krise ist praktisch das Einzige, was die EU und die Euro-Zone zusammenhält.
Wenn die Ehe „der Versuch ist, die Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nicht hätte“, wie Woody Allen sagt, dann ist die EU ein Gruppenexperiment, dessen Teilnehmer mit den Problemen fertigwerden müssen, die ihnen erspart geblieben wären, wenn sie sich der Gruppe nicht angeschlossen hätten.
Nichts anderes als eine verschleppte Insolvenz (wie so manche Beziehung auch)
„Wir werden in eine Rettungsgemeinschaft gepresst“, sagt der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, kein Ökonom, aber ein Mann mit gesundem Menschenverstand.
In dieser Situation, die einer verschleppten Insolvenz gleichkommt, kommt die Kanzlerin daher und sagt: „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“ Einige Zeitgenossen runzeln ob dieser Plattitüde die Stirn, die meisten aber nicken zustimmend. Klingt gut.
Man muss nur etwas richtig wollen, dann geht es auch. „Die Welt als Wille und Vorstellung.“ Schopenhauer grüßt aus der Gruft. Die Kanzlerin habe „die Sache an sich gezogen“, schreiben die Kommentatoren ohne jeden Anflug von Ironie.
Griechenland hatte schon einmal einen deutschen Regenten, Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach, der das Land von 1835 bis 1862 regierte. König Otto I. wurde immerhin von der griechischen Nationalversammlung zum Staatsoberhaupt gewählt, er residierte in Athen. Angela I. reicht die Fernbedienung.
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Fragt sich nur, wohin
An allen Instanzen und Institutionen vorbei hat sie beschlossen, Griechenland zu retten, so als gäbe es keine Abkommen, die den Umgang der Staaten untereinander regeln.
Wozu haben wir die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank, den Internationalen Währungsfonds, wozu wählen wir ein Europaparlament, wenn am Ende des Tages die Kanzlerin bestimmt, wo es langgeht?
Foto: dpa Der griechische Finanzminister Varoufakis (links) mit Regierungschef Tsipras: Sie haben uns klargemacht, was die Europäische Union ihrem Wesen nach ist: ein ideologisches Konstrukt
In dem Satz „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“ steckt ein autoritäres Potenzial, eigentlich schon eine totalitäre Gebrauchsanweisung. Dass der Wille das Einzige ist, worauf es ankommt, davon war auch die deutsche Generalität überzeugt, als sie Ende 1942 allen Verlusten zum Trotz den aussichtslosen Kampf um Stalingrad fortsetzte.
Ebenso die Führung der DDR, die noch im November 1989 nicht wahrhaben wollte, dass sie abgewirtschaftet hatte. Nein, wo ein Wille ist, da ist nicht immer auch ein Weg, es sei denn, er wird mit diktatorischer Härte durchgesetzt.
Viel Pathos, viel Hysterie
Wie mit frei gewählten Abgeordneten umgangen wird, die sich dem Machtwort der Kanzlerin widersetzen, das haben soeben drei Mitglieder der CDU-Fraktion anschaulich beschrieben. Sie hatten es gewagt, gegen die Rettungspakete zu stimmen, und wurden daraufhin kaltgestellt.
Es wurde sogar versucht, „die Geschäftsordnung (zu) ändern, damit im Bundestag keine Abweichler … mehr zum Euro-Thema sprechen können“, erinnert sich der Abgeordnete Klaus-Peter Willsch, der sich solche Offenheit nur leisten kann, weil er in seinem Wahlkreis mit über 50 Prozent der Stimmen direkt gewählt wurde.
Es geht derzeit nicht darum, Griechenland zu retten. „Es geht“, sagt Claudia Roth, „um das Projekt Europa, unsere europäische Idee“, ein höheres virtuelles Gut. Außerdem wäre ein Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-Zone „ein unkalkulierbares Risiko für die Weltwirtschaft“. Mit weniger mag sich die grüne Vizepräsidentin des Bundestages nicht zufrieden geben.
Von einem „unkalkulierbaren“ Faktor spricht auch der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, meint aber etwas anderes. Im griechischen Parlament sitze eine Neonazi-Partei, „echte Nazis, richtige Freunde des Führers“, die könnten Unruhen anzetteln. Er glaube auch, „dass Griechenland, wenn es nicht mehr im europäischen Verbund wäre, zu einem unkalkulierbaren Partner würde“, es könnte sich China oder Russland an den Hals werfen.
Wir sitzen im falschen Zug
Ja, Hysterie gehört zum Handwerk. Wenn der Euro scheitert, scheitert nicht nur Europa, dann wird auch die Akropolis nach Sibirien oder in die Provinz Shandong verlegt. Deswegen muss „das Projekt Europa, unsere europäische Idee“ gerettet werden, wie ein Schiff, das in Seenot geraten ist.
Aber es ist nicht Europa, das kieloben treibt, sondern die EU, eine bürokratische Vision von Europa, die den Praxistest nicht bestanden hat. Dafür lebt in ihr der Geist der DDR weiter: „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“
Ein alter Jude sitzt in einem Zug, sagen wir von Limanowa nach Dabrowa in Galizien. Keine lange Strecke, aber es ist ein langsamer Personenzug, der an jeder Station hält. Und jedes Mal bricht der alte Jude in lautes Wehklagen aus. „Allmächtiger, ich bin verloren, was soll ich nur machen …“
Schließlich erbarmt sich einer der Mitreisenden. „Was haben Sie denn, kann ich Ihnen helfen?“ „Mir kann niemand helfen“, sagt der alte Jude mit Tränen in den Augen, „ich sitze im falschen Zug, und mit jedem Halt wird die Rückreise länger.“
Rettungspakete – wenn Lügen zu Wahrheit werden
- Geschrieben von Peter am Sonntag, 21. Juni 2015 dorfling.de
Dieser Artikel ist an diejenigen gerichtet, die ihre Informationen noch immer aus dem ZDF, der ARD, dem „Spiegel“, dem „Focus“, der „Welt“, der „Süddeutschen“ …, der Bildzeitung und sonstigen „Informationsmedien“ beziehen. Die allermeisten Menschen glauben, weil es ihnen Tag für Tag durch diese „Medien“ eingetrichtert wird, dass mit den unzähligen Rettungspaketen Menschen in Ländern wie Portugal, Irland, Spanien oder Griechenland gerettet werden. Immer wieder muss ich den gleichen Unsinn hören, die faulen Portugiesen, die faulen Griechen oder sonstige faule Menschen werden auf Kosten hauptsächlich der deutschen Steuerzahler gerettet und machen sich ein schönes Leben.
Nein, verdammt noch mal nein, mit all diesen „Rettungspaketen“ werden immer nur Banken unter dem Vorwand gerettet, dass man das Geld des „kleinen Mannes“ oder das eines Staates retten müsse. Das begann schon in den USA, als nach dem Platzen der Immobilienblase Lehman Brothers bankrott ging (oder bankrott gegangen wurde) und deshalb der riesige Versicherungskonzern AIG vor der Insolvenz gerettet werden musste. Hauptnutznießer dieser „Rettung“ waren damals die Deutsche Bank. (12,6 Milliarden), Goldman Sachs ( über 10 Milliarden) und andere mehr. Die Deutsche Bank wäre ohne die Rettung der AIG sofort pleite gewesen, was einen Kollaps des Finanzsystems zur Folge gehabt hätte.
In Europa begann das Unheil mit Einführung des Euros. Staaten, denen das Schuldenmachen bisher schwer fiel, weil sie für ihre Staatsanleihen (nichts anderes als Schuldscheine, die ein Staat herausgibt um sich zu finanzieren), hohe Zinsen bezahlen mussten, konnten sich nun leichter verschulden, weil die Zinsen für ihre Staatsanleihen und die Zinsen allgemein – man hatte ja nun eine „starke“ Währungsunion als Rückhalt – sanken. Das führte dazu, dass viele eh schon klamme Staaten, Investoren und auch Banken viel zu hohe Kredite aufnahmen um mit diesen sinnlose (für ein paar Reiche lukrative) Projekte zu finanzieren. Die Banken waren in ihrer unersättlichen Gier natürlich gerne dazu bereit, jeden Schwachsinn zu finanzieren und scherten sich einen Dreck um die offensichtlichen Risiken. Spanische Kreditnehmer machten bis 2008 über 320 Milliarden Euro Schulden bei deutschen und französischen Banken, um vor allem Immobilien – die niemand brauchte – zu finanzieren. Diese Kredite konnten, weil sich die Immobilien als wertlos erwiesen und deshalb sehr oft nicht einmal mehr fertiggestellt wurden, von den Gläubigern nicht zurückbezahlt werden. Nun hatten die Banken ein Problem. Diese Problem wurde gelöst, in dem man die faulen Kredite einfach auf den Rücken der Steuerzahler umschichtete. Das heißt, man rettete Banken mit Steuergeldern, ließ also die faulen Kredite von den Steuerzahlern begleichen. So zum Beispiel auch die Hypo Real Estate in Deutschland, die mit 123 Milliarden Euro Garantien und 7,7 Milliarden Euro Direkthilfen gerettet und 2009 verstaatlicht werden musste.
Diese nur als schwachsinnig und verantwortungslos zu bezeichnende „Bankenretterei“ brachte dann schon sehr bald die ersten Staaten wie Irland, Spanien und Portugal in ernsthafte Bedrängnis, was dazu führte, dass nun nicht nur mehr Banken sondern auch Staaten gerettet werden mussten. Doch auch mit diesen „Staatenrettungen“ wurden wieder nur sich verzockte Banken und private Investoren (ein Großteil davon in Deutschland ansässig) vor drohenden Verlusten gerettet. Die zu rettenden Staaten erhielten so gut wie kein Geld. Schlimmer noch, diese Staaten wurden dazu gezwungen, die Renten und Sozialleistungen ihrer Bürger zu kürzen und das von ihnen erarbeitete Staatseigentum an die Schuldigen der Krise – Investoren und Banken – zu verschleudern. Das geschah und geschieht weiterhin unter dem Deckmantel sogenannter notwendiger Reformen. In ganz Europa werden seit Beginn der Krise Bürger für die fehlgeschlagene Zockerei von Investoren und Banken in Haftung genommen. Die Bürger Europas müssen mit ihrem Hab und Gut deren Spielschulden begleichen.
Dabei stießen die Handlanger der Finanzindustrie – die Brüsseler Junta und die Regierungen der Euro-Staaten – für lange Zeit auf keinen nennenswerten Widerstand. Doch nun begehrt die erst seit ein paar Monaten im Amt befindliche griechische Regierung gegen diese vollkommen absurde, nur die Taschen der sich verzockten Finanzindustrie wieder füllende „Rettungspolitik“ auf. Wie nicht anders zu erwarten, reagierte das der Finanzmacht hörige europäische Regierungsgesindel geradezu geschockt auf den Widerstand und fiel, unterstützt von den gleichgeschalteten Mainstream-Medien über Tsipras, Varoufakis und Co. her. Eine beispiellose Kampagne gegen die griechische Regierung und auch gegen das griechische Volk wurde losgetreten und wird weiterhin geführt, nur um gleichgeartete und gleichdenkende Menschen gegeneinander aufzubringen. Doch genau dieses Regierungsgesindel war es, dass Griechenland aufgrund der von Goldman Sachs geschönten Bilanzen in den Reigen des Euros aufnahm. Man hatte nur nicht damit gerechnet, dass es in Griechenland jemals dazu kommen würde, dass eine ebenfalls korrupte Regierung durch eine dem Volk dienende ersetzt werden könnte.
Nun steht es da, das von Angstschweiß durchnässten, unfähigen und korrumpierten Politikern geführte Europa. Auch wenn es gelungen ist, die zumeist tumben Bürger Europas gegen die griechische Regierung und die griechische Bevölkerung aufzubringen, ob sich beide auch weiter unterjochen lassen werden, das ist noch nicht entschieden. Bleibt Griechenland hart und zeigt sich nicht gewillt, sich einer Finanzdiktatur zu unterwerfen und sollten sich die „Institutionen“ (ehemals Troika, bestehend aus Internationalem Währungsfonds IWF, Europäischer Zentralbank EZB und Europäischer Kommission) nicht zu Kompromissen bereit erklären, dann wird ein nicht mehr zu löschender Brand dem unsäglichen Treiben in Europa den Garaus machen.
Eigentlich hätte ich mir es ersparen können, diesen Beitrag zu schreiben, denn egal welche Entscheidungen bezüglich Griechenland auch in den nächsten Tagen oder Wochen getroffen werden, spielt keine großartige Rolle mehr. Das gesamte System ist am Ende und ob nun doch noch eine Einigung mit Griechenland erzielt wird oder nicht, das beschleunigt oder verzögert den unausweichlichen Systemkollaps nur noch auf absehbare Zeit.
Mir ging es in diesem Beitrag nur darum, zum zigsten Male darauf hinzuweisen, dass die von den Mainstream-Medien und der Politik propagierte und in die Gehirne gebrannte „Wahrheit“ nichts mit der Realität gemein hat, dass immerzu wiederholte Lügen zur „Wahrheit“ werden.
Und nein liebe Leser, das was ich gerade geschrieben habe, werde ich nicht mit Quellen, Daten, Fakten und Beweisen – die bisher auch niemanden interessierten – untermauern. Diese Beweise kann jeder, der noch fähig ist selbständig zu denken und zu recherchieren, selbst finden. Ja, das ist ein wenig anstrengend aber auch nicht anstrengender, als sich zu merken, wer das Siegestor im Spiel X gegen Y am soundsovielten 2013 geschossen hat. Und denjenigen, die den Text bis hierher nicht aufnehmen konnten, also gar nicht bis hier gelesen haben, denen ist leider nicht mehr zu helfen. Gemein von mir? Mag sein. Doch immer nett zu sein, das hat mich jahrzehntelange Erfahrung gelehrt, bringt auch nichts.
Ulli Kulke 20.06.2015 Achgut.com
Die “Väter” des Euro haben gepennt. Einfach gepennt
Anlässlich des außergewöhnlichen Gipfeltreffens der europäischen Staats- und Regierungschefs wegen der Griechenland-Krise lohnt es sich, noch einmal nachzulesen, was damals beschlossen wurde, als die Idee des Euro in den 90er Jahren feste Formen annahm.
Da ist zum einen die „Nichtbeistands-Klausel“, Artikel 104b im EG-Vertrag von 1992: „Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein“. Tritt nicht ein, heißt: Es wird einem Mitgliedsstaat untersagt, für die Schulden eines anderen Mitgliedsstaates aufzukommen. Hilfspaket? Verboten! Der Satz wurde so wie er da steht im „Lissabon-Vertrag“ 2009 übernommen, dem „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“.
Des Weiteren heißt es dann in Artikel 123: „Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im Folgenden als “nationale Zentralbanken” bezeichnet) für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken.“
Der Europäischen Zentralbank (EZB) ist es also ausdrücklich untersagt, Staatsschuldpapiere von überschuldeten Ländern aufzukaufen. Sinn der Sache ist es, die einzelnen Mitgliedsstaaten zu Haushaltsdisziplin anzuhalten. Wofür wurden diese Klauseln beschlossen? Ganz klar: für den Krisenfall.
Kaum aber zeigte sich die erste Krise, wurden die dafür geschaffenen Regeln über Bord geworfen. Andere Mitgliedsstaaten treten mit hohen Milliardenbeträgen für Griechenland ein. Und der Chef der Europäischen Zentralbank schießt den Vogel ab, indem er massenhaft Staatsschuldpapiere Griechenlands aufkauft. Statt deshalb umgehend zurückzutreten, kündigt er anschließend an, diesen Ankauf zur Not in „unbegrenzter Höhe“ weiterzutreiben. Um den Staat Griechenland zu finanzieren – ein Sakrileg für jede unabhängige Geldpolitik.
Draghi hat sich seinen Bruch dieser zentralen Regel durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) genehmigen lassen, der argumentierte, dass sich nur so die Geldpolitik der EZB umsetzen ließe, sprich für Stabilität des Euro zu sorgen. Ein bemerkenswerter Persilschein. Die Fiskalpolitik, die Haushaltspolitik also als Instrument oder verlängerter Arm der Geldpolitik. Mit dem Argument ließe sich in beliebigem Ausmaß die Unabhängigkeit jeder Zentralbank ad acta legen, ließe sich die Gewaltenteilung zwischen Geld- und Fiskalpolitik ad absurdum führen. Das Modell wird bei jedem weiteren Krisenfall irgendeines Staates Schule machen, so viel steht fest. Der EuGH hat den Artikel 123 nicht interpretiert, er hat ihn einfach gekippt, mal eben so, im ersten Ernstfall.
Und die Gläubigerstaaten, die nun ein Hilfspaket nach dem anderen für Griechenland schnüren, haben die Haushalts- und Wirtschaftspolitik des Landes in die Nähe einer Naturkatastrophe geführt, denn nur für solche Fälle wäre es erlaubt, einem Staat finanziell unter die Arme zu greifen: nämlich „aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht ist“.
So, eines muss jetzt an dieser Stelle klar gestellt werden: Mit dem Zitieren der damals aufgestellten Regeln will ich nicht den Eindruck erwecken, als wäre bei der Euro-Einführung alles wohlüberlegt und zukunftsfähig aufs Gleis gesetzt worden, beileibe nicht. Ganz offenbar hat man so einen Krisenfall, wie er nun seit Jahren virulent ist, vorhergesehen, sonst hätte man solche Regeln nicht aufgestellt. Ebenso offenbar aber hat man es unterlassen, Vorsorge zu betreiben für den Fall, dass ein Land die Stabilitätskriterien nachhaltig bricht und sich weigert, auf den vorgesehenen Pfad zurück zu kehren. Voller Zuversicht hat man es einfach nicht für nötig gehalten, dafür einen Plan B auch nur anzudenken.
Die Einführung des Euro, so wie sie beschlossen wurde, ist das größte Armutszeugnis der Politik in Europa seit dem Krieg, und so schnell wird man nichts finden, was die Politikverdrossenheit so stark vorangetrieben hat wie die Euro-Krise. Die Euro-Macher, blind vor lauter Zuversicht, haben einfach vergessen, Lösungen für den Krisenfall einzubauen, sie haben lediglich vorgeschrieben, was verboten ist. So als würde das Eheversprechen „bis dass der Tod euch scheidet“ ausreichen, um das Scheidungsrecht einfach abzuschaffen. Trennung wieso? Ist nicht vorgesehen. Noch Fragen?
Schön wenn etwas zusammenwächst, was zusammen gehört, aber auch Trennungen müssen möglich sein, und zwar in möglichst geordneten Bahnen. Vor allem dann, wenn eine gemeinsame Währung eingeführt wird, die Wirtschafts- und Haushaltspolitik aber Sache jedes einzelnen Staates bleibt, egal ob mit konservativer oder kommunistischer Führung. Wenn in letzter Konsequenz jeder Staat mit seinem Geld machen kann, was er will, weil eine Trennung nicht vorgesehen ist, so wie bei einem Ehepaar, das sich nicht trennt, weil es keine zweite Wohnung gibt.
Die Turbulenzen, die bei einem Grexit jetzt befürchtet werden, erscheinen doch nur deshalb so unermesslich, weil kein Mensch, kein Politiker und kein Wirtschaftswissenschaftler, klar sagen kann, wie ein solcher Schritt ablaufen würde und deshalb erst Recht nicht, welche Folgen er haben würde. Es gibt keinen Plan. Rausschmiss? Eigene Kündigung? Kein Ahnung, vorgesehen ist nichts. Das Wunschdenken hat klare Überlegungen ausgeschaltet, und das bei einem Jahrhundertprojekt wie dem Euro, man stelle sich vor. Es unfassbar, eigentlich nicht zu glauben, dass an so etwas niemand gedacht hat, dass jeder Gedanke letztlich zumindest unterdrückt, eingestellt wurde.
Die Väter der Gemeinschaftswährung haben gepennt, einfach gepennt, so muss man es wohl sehen.
Die Folge: Keine größere Zeitung, in der dieser Tage nicht Szenarien für einen Grexit geschildert werden. Diametraler könnten sie nicht auseinander fallen, jede darf sich selbst – abhängig von Griechenlandsolidarität oder Marktbekenntnis – seine eigene Version zurecht legen. Mag sein, dass man dadurch, dass man jeden Gedanken an einen Austritt im Keim erstickte, Turbulenzen auf den Märkten vermeiden wollte. Jetzt sieht man: Das genaue Gegenteil droht, und lähmt die Akteure bis zur Untätigkeit, zwingt sie zu unsäglichen Hängepartien.
Dieses Versäumnis ist nicht nur ein Vergehen an den Gläubigern, mehr noch an den Schuldenstaaten. Ein geordneter Rückzug, für den es feste Regeln gegeben hätte, böte Griechenland sicher größere Überlebenschancen als eine schreckliche Zwangsehe mit überstarken Partnern. Ein Rückzug aus dem Euro muss keinen Rückzug aus der EU bedeuten, die sich anschließend ungleich freier und erlöster um Solidarität, um Entwicklungshilfe für Griechenland kümmern könnte als unter den heutigen chaotischen Umständen. Es hat schließlich einen Grund gegeben, warum Gemeinschaftswährungen wirtschaftspolitisch unabhängiger Staaten die Ausnahme blieben. Die Währung ist der unerlässliche Puffer zwischen allzu unterschiedlichen ökonomischen Strukturen. Eine Abwertung wäre für Griechenland jetzt unerlässlich. Geht nicht.
Es hat auch ein Griechenland vor dem Euro gegeben. Und, das kann man nicht oft genug feststellen: Rot-grün hat den Euro nicht geschaffen. Aber die Bundesregierung hat im entscheidenden Moment dafür gesorgt, dass Griechenland gegen die Warnung von Experten in den Euro aufgenommen wurde. Finanzminister Eichel hat deshalb einen Direktor der Bundesbank zusammenfalten lassen. Der Bundesbank, die eigentlich unabhängig gewesen sein sollte – eigentlich hätte man es damals schon ahnen können.
Zuerst erschienen auf Ulli Kulkes Blog Donner & Doria
Griechenland ist ein Nebenschauplatz. Die Eurozone ist gescheitert und Opfer sind auch die Deutschen | Aditya Chakrabortty
Fast jede Diskussion über das griechische Fiasko basiert auf einem Moralstück. Nennen wir es Unartiges Griechenland gegen Edles Europa. Diese lästigen Griechen hätten nie in die Eurozone gehört, geht die Geschichte. Nachdem sie dabei waren, haben sie sich in dicke fette Schwierigkeiten gebracht – und jetzt muss Europa es ausbaden.
Das sind die Grundlagen über die sich alle Weisen einig sind. Die auf der Rechten sagen dann weiterhin, dass das nichtsnutzige Griechenland entweder Europas Deal akzeptieren muss oder aus der Einheitswährung austreten soll. Oder, bei den etwas Liberaleren, drucksen sie herum und räuspern sie sich bevor sie an Europa appellieren, etwas mehr Wohlwollen gegenüber seinem südlichen Problemfall zu zeigen. Wie auch immer ihre Lösung aussieht, die Weisen sind sich hinsichtlich des Problems einig: die Schuld liegt nicht bei Brüssel, sondern in Athen. Oh diese turbulenten Griechen! So scheint die Haltung etwa wenn Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfond die Syriza-Regierung als nicht “erwachsen” genug zurechtweist. Das ist es, was der deutschen Presse die Erlaubnis erteilt, den griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis als jemanden, der “psychiatrische Hilfe” braucht, zu porträtieren.
Es gibt nur ein Problem mit dieser Geschichte: wie die meisten Moralstücke zerbricht es an der harten Realität. Athen ist nur das schlimmste Symptom einer viel größeren Krankheit innerhalb des Europrojekts. Denn die Einheitswährung zahlt sich für die normalen Europäer zwischen Ruhr und Rom nicht aus.
Wenn ich dies sage, schließe ich meine Augen nicht vor der endemischen Korruption und der Steuerhinterziehung in Griechenland (und in der Tat tut dies auch die Outsider-Bewegung Syriza nicht, die genau wegen ihrer Kampagne gegen diese Verfehlungen an die Macht gekommen ist). Auch werde ich nicht in die Nadelstreifen von Nigel Farage schlüpfen. Meine Anklage ist viel einfacher: das Europrojekt scheitert nicht nur daran, die Versprechen seiner Gründer zu erfüllen, es tut das genaue Gegenteil – indem es den Lebensstandard der einfachen Europäer aushöhlt. Und wie wir sehen werden, gilt dies sogar für die, die im Land der Nummer Eins unter den Wirtschaften des Kontinents leben, Deutschland.
Erinnern wir uns erstens an die edlen Versprechen, die dem Europrojekt gemacht wurden. Spielen wir das unscharfe Bildmaterial von Deutschlands Helmut Schmidt und Frankreichs Giscard d’Estaing, wie sie die Grundfesten für Europas großen Einiger legen. Vor allem, erinnern wir uns daran was die wahren Gläubigen gefühlt haben. Nehmen wir folgendes von Deutschlands Finanzminister Oskar Lafontaine am Abend der Euroeinführung. Er sprach von einer “Vision eines vereinigten Europas, die über die graduelle Angleichung von Lebensstandards, einer Vertiefung der Demokratie und dem Erblühen einer wahren europäischen Kultur erreicht werden wird”.
Wir könnten tausende solcher Strophen der Euro-Poesie rezitieren, aber die einzelne Zeile Lafontaines zeigt, wie tief das Einzelwährungsprojekt gefallen ist. Anstelle einer Anhebung der Lebensstandards in Europa, drückt die Währungsunion diese nach unten. Statt die Demokratie zu vertiefen, höhlt sie sie aus. Was die “wahre europäische Kultur” angeht – wenn deutsche Journalisten griechische Minister einer “Psychose” bezichtigen, ist die mythische Agora der Nationen weit entfernt.
Von allen drei Vorwürfen ist der erste am wichtigsten – denn er erklärt wie die gesamte Einheit unterhöhlt wird. Um zu verstehen was mit den Lebensstandards einfacher Europäer passiert ist, wenden wir uns der außergewöhnlichen Studie zu, die dieses Jahr von Heiner Flassbeck, dem ehemaligen Chef-Volkswirt der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, und Costas Lapavitsas, einem Wirtschaftsprofessor an der SOAS Universität in London und Syriza Parlamentsmitglied, veröffentlich wurde.
Der Deutsche und der Grieche veröffentlichten in Against the Troika eine Statistik, die die Idee, dass der Euro die Lebensstandards verbessert hat, platzen lässt. Was sie sich angesehen haben sind die Lohnkosten je Produktionseinheit – wie viel den Angestellten für das Arbeitsergebnis einer Produktionseinheit bezahlt werden muss: sagen wir für ein Widget oder ein Stück Software. Und sie bilden die Lohnkosten der Eurozone von 1999 bis 2013 ab. Das Resultat ist, dass deutsche Arbeiter in den letzten 14 Jahren kaum Lohnerhöhungen bekommen haben. Über die kurze Lebensdauer des Euro haben Deutsche schlechter abgeschnitten als die Franzosen, Österreicher, Italiener und viele andere in Südeuropa.
Ja, wir sprechen über das gleiche Deutschland: die stärkste Wirtschaftskraft des Kontinents, die sogar David Cameron mit Neid betrachtet. Doch die dort arbeitenden Menschen, die dem Land Wohlstand gebracht haben, haben kaum Entlohnung für ihren Einsatz gesehen. Und das ist das Modell für den Kontinent.
Vielleicht haben wir ein Bild von Deutschland als einer Nation gut ausgebildeter, gut entlohnter Arbeiter in glänzenden Fabriken. Diese Arbeitskraft und seine Gewerkschaften existieren noch immer – aber sie schrumpfen schnell. Was sie ersetzt, laut Deutschlands führendem Experten für Ungleichheit, Gerhard Bosch, sind Drecksjobs. Er schätzt, dass die Anzahl der Niedriglöhner in die Höhe geschossen und jetzt fast auf dem Level der USA ist.
Kreiden wir das nicht dem Euro an, sondern dem schleichenden Verfall deutscher Gewerkschaften und dem Unternehmenstrend ins billigere Osteuropa auszulagern. Was die Einheitswährung geschafft hat, ist Deutschlands Niedriglohnprobleme zum Ruin eines gesamten Kontinents zu machen.
Die Arbeiter in Frankreich, Italien, Spanien und dem Rest der Eurozone werden jetzt durch einen epischen Lohnstopp im gigantischen Land in ihrer Mitte ausgebootet. Flassbeck und Lapavitsas beschreiben das als Deutschlands “beggar-thy-neighbour”-Politik (wörtlich: ruiniere deinen Nachbar) – “aber erst nachdem es seine eigene Bevölkerung ruiniert hat”.
Im letzten Jahrhundert hätten die anderen Länder in der Eurozone durch Abwertung ihrer Nationalwährungen wettbewerbsfähiger werden können – ebenso wie Großbritannien es seit der Bankenkrise getan hat. Aber nun sitzen alle im selben Boot, die einzige Lösung nach dem Absturz war den Arbeitern weniger zu bezahlen.
Das ist explizit was die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und der IWF Griechenland sagen: entlasst Arbeiter, zahlt denen, die noch einen Job haben, weniger und kürzt die Renten der Pensionäre. Aber nicht nur in Griechenland. Fast jedes Treffen der Weisen in Brüssel und Strasbourg führt zu dem gleichen Kommuniqué zur “Reform” des Arbeitsmarktes und der Sozialgesetzansprüche auf dem Kontinent: ein wenig kodierter Ruf nach einem Angriff auf den Lebensstandard einfacher Leute.
So verwandelt sich das noble europäische Projekt in einen düsteren Marsch auf den Tiefstand. Es geht nicht um die Schaffung einer tiefersitzenden Demokratie, sondern um tiefergreifende Märkte – und die zwei sind zunehmend unvereinbar. Deutschlands Angela Merkel hat keine Gewissensbisse gezeigt, sich in die demokratischen Angelegenheiten anderer europäischer Länder einzumischen – beispielsweise indem sie die Griechen stillschweigend davor warnt Syriza zu wählen oder indem sie den sozialistischen Premierminister Spaniens, José Luis Rodríguez Zapatero, zwingt die Kostenverbindlichkeit aufzugeben, mit der er die Wahl gewonnen hatte.
Die diplomatischen Prügel, die Syriza verabreicht wurden seit sie an die Macht gekommen ist, können nur als Beispiel Europas an die spanischen Wähler gewertet werden, die versucht sein könnten Syrizas Schwesternpartei Podemos zu unterstützen. Wagt euch zu weit nach links, heißt die Nachricht, und euch widerfährt die gleiche Behandlung.
Was auch immer die Gründungsideale der Eurozone sein mögen, sie halten nicht mit der düsteren Realität des Jahres 2015 mit. Das ist Thatchers Revolution, oder Reagans – aber nun in einer kontinentalen Größenordnung. Und dabei wird sie von der Idee begleitet, dass es keine Alternative gibt, entweder dazu eine Wirtschaft am Laufen zu halten oder sogar dazu welche Regierung die Bürger wählen können.
Die Tatsache, dass diese ganze Show von umgänglich erscheinenden Weisen, die oft behaupten sozialdemokratisch zu sein, veranstaltet wird, macht das Projekt nicht netter oder freundlicher. Es gibt der ganzen Sache nur den unangenehmen Beigeschmack von Scheinheiligkeit.
This article was translated by Caroline Fries. To comment, click here for the English version
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/23/griechenland-eurozone-deutschen-einheitswahrung

faz.net 25.06.2015, von Philip Plickert
Griechische Schuldenkrise: Konkursverschleppung durch die EZB
Die griechischen Banken und indirekt auch der Staat hängen am Tropf der Europäischen Zentralbank. Schon fast 90 Milliarden Euro beträgt die Liquiditäts-Nothilfe der griechischen Notenbank, welche die EZB gebilligt hat. Innerhalb einer Woche hat sie diese „Emergency Liquidity Assistance“ (Ela) viermal erhöht. Viele Notenbankchefs im EZB-Rat haben nur noch mit Bauchschmerzen zugestimmt, einige opponierten offen, weil sie nicht bei einer Konkursverschleppung und monetären Staatsfinanzierung (über die Banken) mitmachen wollen.
Den hellenischen Banken steht das Wasser bis zum Halse. Angesichts des eskalierten Schuldendramas haben viele Kunden ihre Konten leergeräumt. Es ist ein Bank-Run auf Raten. Rund 40 Milliarden Euro Einlagen hat das griechische Bankensystem in den vergangenen sechs Monaten verloren. Deshalb werden in mancher Bank die Barmittel knapp. Da die Banken keinen Zugang zu Marktfinanzierungen mehr haben, ist Ela ihre letzte Rettung. Zur Wochenmitte hat sich die Lage etwas beruhigt. Aber die Krise kann neu aufflammen, denn von einer endgültigen Lösung der Schuldentragödie ist man noch weit entfernt.
Die Ela-Notkredite sollen eigentlich nur über eine temporäre Finanzklemme hinweghelfen. Banken, die sie in Anspruch nehmen, dürfen nicht insolvent sein. Es ist aber mehr als zweifelhaft, ob die griechischen Banken noch so solide kapitalisiert sind, wie die EZB behauptet. Offenbar drücken die Aufseher der Zentralbank mehr als ein Auge zu, sonst müsste der EZB-Rat die Nothilfen stoppen. Damit würde er nicht nur den Banken den Geldhahn zudrehen, sondern auch den Grexit auslösen, das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum. Das möchte EZB-Präsident Mario Draghi auf jeden Fall vermeiden.
Varoufakis: dubiose Phantomanleihen
„Die Grenze zwischen Ela und Konkursverschleppung ist fließend“, kritisiert die langjährige oberste deutsche Bankenaufseherin, Elke König, mit Blick auf Griechenland. Das Problem der dortigen Banken ist die Masse fauler Kredite. Mehr als 40 Prozent der Kredite (Gesamtsumme 210 Milliarden Euro) sind notleidend, weil Schuldner mit Zins- oder Tilgungsraten im Verzug sind. Dem wachsenden Berg fauler Kredite von mehr als 80 Milliarden Euro stehen Rückstellungen für Verluste von nur 40 Milliarden Euro entgegen.
Die Schwachstelle der griechischen Banken ist ihr Eigenkapital. Zwar hat die EZB bei der Prüfung der Bilanzen im vergangenen Jahr für die hellenischen Institute den Daumen gehoben, ihre Kernkapitalquoten erschienen gut. Doch der Schein trügt. Große Teile des Kapitalpuffers sind selbst faul: Das trifft vor allem auf die Steuergutschriften zu, die Banken nach dem internationalen Regelwerk Basel III für eine Übergangszeit noch zum Eigenkapital zählen dürfen. Mehr als 13 Milliarden Euro, ein Viertel des Eigenkapitals der griechischen Finanzinstitute, sind Steuergutschriften für Verlustvorträge – also Forderungen an den faktisch bankrotten griechischen Staat.
Kurz vor seiner Wahl zum Finanzminister schrieb Giannis Varoufakis in seinem Blog in dankenswerter Klarheit: „Das Ela-System gestattet einfach nur den bankrotten Banken, die ein bankrotter Fiskus nicht zu retten vermag, sich von der Bank of Greece Geld gegen Pfänder zu leihen, die nicht viel wert sind.“ Die Pfänder, die sie bei der Notenbank hinterlegen, sind zum Teil sehr dubios. Dazu zählen vom Staat garantierte Bankanleihen für 50 Milliarden Euro. „Phantomanleihen“ nannte Varoufakis diese Papiere.
Politische Agenda der EZB
Was für ein Irrsinn: Ein bankrotter Staat stützt angeschlagene Banken, die wiederum über den Kauf von kurzlaufenden Staatsanleihen den Staat finanzieren. Hier klammern sich zwei Ertrinkende aneinander. Die Europäische Zentralbank schaut zu. Indem sie die Nothilfen immer weiter erhöht, ermöglicht sie es der Regierung Tsipras, im Streit um Schulden und Reformen hoch zu pokern. Gegenüber Zypern dagegen drohte die EZB vor zwei Jahren unverblümt mit dem Ende der Nothilfen.
Die EZB schüttet über die Bank of Greece gewaltige Summen Ela-Geld in das löchrige hellenische Bankensystem und finanziert damit letztlich die Kapitalflucht. Diese zeigt sich am griechischen Target-Saldo. Seit der Ankündigung der Neuwahlen, die Syriza an die Macht brachten, hat sich der griechische Target-Saldo – also die Schuld der Notenbank bei anderen Zentralbanken des Eurosystems – auf rund 100 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. So hoch steht die Bank of Greece beim Eurosystem in der Kreide. Bei einem Austritt Griechenlands aus dem Euro wäre dieses Geld wohl weg. Das ist ein zusätzliches Verlustrisiko für die Steuerzahler Europas.
- Athens Geldgeber verlangen Nachbesserungen
- Kommentar zu Griechenland: Eine Rettung, die das Problem nicht löst
- Griechenlands Schuldenkrise: Athener Ökonomen kritisieren Kompromiss mit Tsipras
- Piketty fordert große europäische Schuldenkonferenz
- Tauziehen um Griechenland: Abreise ohne Kompromiss
- Live-Blog Griechenland: Die Minister verhandeln wieder
Um das Ausbluten der griechischen Banken und das Risiko für die europäischen Steuerzahler zu stoppen, wäre die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen überfällig. Sie würden zwar die Wirtschaft behindern, doch zeigt das Beispiel Zypern, dass sie eher stabilisierend als strangulierend wirken können. Es ist unverständlich, warum die EZB den Ela-Hebel nicht eingesetzt hat, um Athen zu Kapitalverkehrskontrollen zu bewegen. Offenbar ist die EZB nun eine hochgradig politisierte Institution. Griechenland soll gerettet werden – koste es, was es wolle.
Mi(e)ses zu Griechenland
(Eine Warnung vorab: heute wird es sehr anstrengend).
Die ganze österreichische Schule um Hayek und Mises ist mir im Prinzip ein Gräuel. Ein großer Apologet dieser „Denkrichtung“ ist der Vertreter des Anarchokapitalismus, Hans-Hermann Hoppe, der in meinem Alter ist, was bedeutet, dass es auch alte Männer gibt, denen man besser nicht so lauscht. Wer es tun möchte, dem empfehle ich das Guugeln. Ich selbst habe viele seiner Youtube-Vorträge gehört, denn interessant sind sie immer, weil ich offen bin für alle Ideen und Gedanken, die so gedacht werden. Aber meine Empfehlungen wären manipulativ, denn ich würde nur die vorschlagen, die besonders „strange“ sind.
Von meinem Vater habe ich die Weisheit geerbt, dass man auch von einem Esel etwas lernen kann. Deshalb bin ich strikter Gegner von Gedankenverbote aller Art geworden. Bei mir darf jeder denken was er will. Ob Hohlwelttheorie, ob Aluhütchenträger, Chemtrailjünger (bitte keine diesbezüglichen Kommentare!), Holocaustleugner, Katholen oder Salafisten. Jeder hat das Recht auf den eigenen Glauben (= möglicher Irrglaube für andere?), so lange – und das ist meine Einschränkung – er/sie/es mir nicht damit auf die Testikel geht, oder diese Meinung (mit oder ohne Terror) für alle verbindlich erklärt wird. Freiheit ist das Recht, manches nicht tun oder glauben zu müssen.
Mit der Gedankenwelt von Hoppe habe ich mich schon in früheren Jahren hier auseinandergesetzt, deshalb möchte ich mich nicht wiederholen (wen es interessiert, dem schicke ich gerne das damals Geschriebene zu). Wenn ich jetzt trotzdem diesen Artikel von Hoppe empfehle, dann deshalb, weil er auf einige Dinge hinweist, die in dem Feld-Wald-und-Wiesen-Talgschau-Geschwätz nicht vorkommen: In Griechenland hat sich eigentlich nichts geändert. Ob es dort einen Euro, eine Drachme, oder keine Währung gibt, ist im Prinzip nur für Buchhalter und deren Philosophie (man könnte es auch als „Glaube“ bezeichnen) wichtig. Der Liebeskummer einer jungen Griechin und die Gefühle eines alten Alexis Sorbas bleiben eigentlich gleich. Die Werte, die Häuser, Felder sind nach wie vor da. Griechenland ist nicht geschrumpft und der Wein sollte noch immer gut schmecken. Muss der Hafen von Piräus, die Autobahnen und so weiter an ausländische Gängster (Entschuldigung, ich meine „Investoren“) verscherbelt werden, damit alles besser wird? Besser für wen? Der eigentliche Verbrecher ist unsere Qual_itätsregierung, die das – normalerweise in Sonntagsreden – hochgelobte „Unternehmerische Risiko“ von den Bänkstern auf den Steuerzahler verlagert hat. Griechische Staatsanleihen hatten die französischen und deutschen Banken (besonders der „im Kanzleramt seinen Geburtstag“ feiernden Starbänkster Ackermann) in ihrem Portfolio. Wer hat unsere Regierung beauftragt, denen die faulen Kartoffeln zu Höchstpreisen abzukaufen? Too Big to Fail, Too Big to Jail! Ich lach‘ mich tot. Verbrecher – ob gewählt oder nicht – gehören hinter Schloss und Riegel – und nicht ins Kanzleramt. Diese Art des Kapitalismus ist (für Kapitalisten) ein Erfolgsmodell: Geht’s gut, kassieren die Eigner, geht’s schief, darf der Steuerzahler den Arsch hinhalten. Marktwirtschaft soll das sein?
Der Artikel des Herrn Hoppe verkennt nämlich genau diese Tatsache. Nicht der Staat hat „fehlinvestiert“, sondern er hat den „fehlinvestierenden“ Kapitalisten ihren Reibach gesichert. Hoppes Grimms-Märchen-Schönwetterkapitalismus gibt es nämlich im 21sten Jahrhundert nicht mehr. Das „unternehmerische Risiko“ der Konzerne, die die Welt regieren ist de facto nicht vorhanden. Der liebe Hoppe möchte mir bitte mal sagen, wo die „Erstinbesitznahme“ überhaupt noch möglich ist:
Jede Person ist darüber hinaus privater Eigentümer aller derjenigen natur-gegebenen Güter (Dinge), die sie zuerst als knapp wahrgenommen und mit Hilfe ihres eigenen Körpers zu nutzen und bearbeiten begonnen hat, d.i., bevor dieselben Güter von anderen Personen als knapp wahrgenommen und benutzt wurden. Wer sonst, wenn nicht der erste Nutzer, sollte ihr Eigentümer sein? Der zweite Nutzer, oder der erste und der zweite gemeinsam? Doch dann würde Konflikt wiederum zweckwidrig erzeugt, statt vermieden! (aus diesem Aufsatz).
Unseren Ökonomen fehlt vielleicht die Phantasie oder sie agieren als Mietmäuler, aber eine Ökonomie, die als Grundlage die Ressourcenverteilung eines Robinson Crusoe als Basis hat, kann ich so ganz ernst nicht nehmen. Der arme Neger in Afrika konkurriert nicht mit anderen armen Negern, sondern mit Nestlé. Wenn Prämissen falsch sind, kann Richtiges nur zufällig als Ergebnis entstehen. Da ist mir die kalte Nüchternheit eines Karl Poppers lieber.
Jede Philosophie oder Weltanschauung sollte zuerst die Eigentumsfrage geklärt haben, bevor höhere Stufen erklommen werden. Ich könnte auch schreiben, man sollte die Machtfrage klären, aber die stellt sich erst, wenn die Eigentumsfrage geklärt ist. Man sollte die Griechenlanddebatte darauf hin untersuchen.
Den Christen empfehle ich mal nachdenken, was im Vaterunser steht: „… und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern„. Damit sind „Schulden“ (debts), im banalen – nicht im metaphysischen (guilty) – Sinne gemeint. Vielleicht erklärt diese Predigt mehr? Weshalb sind es vorwiegend die katholischen Christen in der „christlichen“ Partei, die nicht wissen, was sie so in ihren Gebeten hirnlos runterleiern? Ich finde dies nachdenkenswert; Wie ernst nehmen die eigentlich ihren Glauben? Außerdem, wir haben ganz andere Probleme!
http://www.altermannblog.de/mieses-zu-griechenland/
Europa und der Grexit: Wenn Politik Wirtschaft außer Kraft setzt
Von Roland Tichy 30.06.15 Achgut.com
“Was wirtschaftlich verkehrt ist, kann politisch nicht richtig sein“; mit diesem Satz stemmte sich der damalige FAZ-Kommentator Hans D. Barbier in den 90ern gegen die Währungsunion.
Bekanntlich vergeblich. Seither hat sich Europa verändert – was politisch wünschbar ist, wird gemacht, die Wirtschaft hat zu folgen wie der Dackel dem Herrn. Und Wirtschaft – damit werden seither einseitig Konzerne und Unternehmer verstanden. Bekanntlich vergeblich. Seither hat sich Europa verändert – was politisch wünschbar ist, wird gemacht, die Wirtschaft hat zu folgen wie der Dackel dem Herrn. Und Wirtschaft – damit werden seither einseitig Konzerne und Unternehmer verstanden.
Die Ekstase der Politik
Jedenfalls bis zu diesem Wochenende; bis zum Scheitern der Verhandlungen über noch ein griechisches Rettungspaket. Eine wahre Orgie der „nationalpopulistischen Ekstase“ (so der frühere griechische Kurzzeit-Finanzminister Evangelos Venizelos) erschüttert das griechische Parlament; da ist viel von „Demütigung“ und “heldenhaftem Kampf“ die Rede, von Volk und Ehre – und dabei geht es doch bloß darum, ob die EZB per ELA die Geldautomaten auffüllt oder dafür frecherweise Gegenleistungen verlangt. Rhetorisch herrscht der spanische Bürgerkrieg, marschieren die Faschisten, und dazu passt, dass der rechtsradikale griechische Verteidigungsminister davon sprach, den „Kougi zu machen“ – auf diesem Hügel sprengten sich Widerstandskämpfer lieber in die Luft, statt zu kapitulieren. Und all das Getöse wegen 1,6 Mrd. IWF-Schulden? Nirgendwo wird die infantile Haltung deutlicher als in dieser Debatte, in der Phantasien gepflegt wurden und Rationalität strikt vermieden. Politik eben statt Rechnen, wie man mit möglichst wenig Ressourcen ein Maximum an Ergebnis erzeugt – Wirtschaft eben. Aber die braucht ja keiner mehr, wenn die Politik sie außer Kraft setzt.
Alle schimpfen jetzt auf Alexis Tsipras und seinen Finanzminister Yanis Varoufakis; dabei wurde er noch im Januar von der Wirtschaftswoche als „sexy“ und beispielgebend für Europa auf dem Titel gefeiert. Wer jetzt diese Griechen tadelt, tadelt Europa.
Griechenland ist Europa at its Best
Denn Griechenlands neue Regierung ist eigentlich der Höhepunkt dieser Entwicklung, in der die Politik triumphiert und Wirtschaft nicht mehr zählt. Sie argumentiert immer „politisch“, und das ist ein neues Synonym für Wunschdenken. Nicht mit den Zahlenknechten, den Finanzministern, wollte man verhandeln – sondern auf Ebene der Regierungschefs; denn die sind wie Gott, ihr Wort ist Gesetz der Wunscherfüllung.
Die Wirtschaft ist nur noch da, dieses Wunschdenken zu realisieren. Höhere Renten? Das ist nur gerecht. Höhere Löhne? Jede Arbeit muß nicht nur bezahlt, sondern mit einem höheren Lohn auch noch „wertgeschätzt“ werden. Mindestlöhne? Im Zweifelsfall zu niedrig; die Unternehmer verweigern höhere Löhne nur aus Hartherzigkeit. Geld? Kann gedruckt werden, dazu haben wir Mario Draghi in seinem Glaspalast. Schulden? Dehnbar, verschiebbar, verhandelbar.
Europa – und übrigens auch Deutschland – hat sich in einen Rausch der politischen Möglichkeiten gesteigert, in dem Wirtschaft nur noch die Dienstmagd ist, der Knecht, der den Politikern an ihren übervollen Tisch die nächste Flasche aus dem Keller zu bringen hat.
Mit den Wörtern haben sich die Werte verschoben: Alles ist irgendwie Demokratie, alles verhandelbar, alles per Mehrheitsentscheidung herstellbar. Warum sollen die Griechen nicht darüber abstimmen, wieviel Geld ihnen aus Europa zufließen soll oder dass sie die Rückzahlung alter Schulden verweigern? Demokratie ist, wenn für höhere Renten gestimmt wird, ohne zu überlegen, wer sie finanziert. (Dass Griechenland ähnlich überaltert ist wie Deutschland und in den kommenden Jahrzehnten zu einem verarmenden Altersheim wird – ach ja? Fakten werden gerne weggestimmt.) Die Vorherrschaft des Politischen feiert ihre Triumphe.
Übrigens ja nicht nur in Griechenland. „Macht uns der Kapitalismus kaputt“, wollte die süddeutsche Zeitung am Montag danach wissen und lieferte 13 Zahlen von Burn-Out bis Gini-Koeffizienten, mit dem die skandalöse Ungleichverteilung nachgewiesen werden soll, die sich in der Lebenswirklichkeit einfach nicht einstellen will. Irgendeine Alternative? Geschwurbelte Fehlanzeige. Aber irgendwie hängt alles mit allem zusammen, nur nicht mit Logik, was die vorherrschende linke Verschwörungstheorie über Kapitalisten, die noch keiner je gesehen hat, ja ohnehin auszeichnet: dumpfes Ahnen, gieriges Wollen, tumbes Nicht-Verstehen als Welterklärung. Und deshalb führt Deutschland die Rente mit 63 wieder ein – Andrea Nahles würde eine gute Figur machen in der Syriza.
Politikversagen wird verleugnet
Richtiger wird es nicht, wenn man dieselben Fehler macht wie die Griechen, nur weil die politische Logik der Koalitionsverhandlung erzwingt, dass man gegen jede Realitätsnotwendigkeit Mütterrenten und Frühverrentung gleichzeitig verabschiedet. Die Wirtschaft, also das, was die Menschen erschaffen, hat zu erbringen, was Berliner Phantasien sich so herbeifabulieren. Vielleicht sollte man sich wieder auf die Grundgedanken des Nobelpreisträgers James Buchanan zurückfinden. Er hat dem lautstark bejammerten „Marktversagen“ den Begriff des „Politikversagens“ entgegen gestellt.
Politik ist danach kein Wahrheitsbetrieb, hat nichts mit dem Gemeinwohl zu tun, wie Deutsche so gerne glauben wollen, sondern ist ein Interessenkampf; und Politiker, man glaubt es kaum, sind keine Engel, sondern Menschen wie Du und ich, also Egoisten. Ihr Handeln ist eher auf ihre Wiederwahl oder ein möglichst hohes Steueraufkommen ausgerichtet, als auf das Gemeinwohl. (James M. Buchanan, Gordon Tullock: The Calculus of Consent – Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor, 1962, 1989.)
Und deshalb muss der Einfluß der Politik begrenzt werden – wobei das Primat der Politik im Verhältnis zur Wirtschaft sowohl das Dritte Reich wie die DDR kennzeichnete. Aber diese Begrenzung des politischen wird zunehmend aufgehoben – und das beste Beispiel ist der Euro und der Umgang mit den dazu gefundenen Regeln: Vermutlich gibt es keine Regel im Maastricht-Vertrag, die nicht gebrochen wurde, wenn es der Politik notwendig erschien, um ihr “Projekt” gegen die Realität zu verteidigen. Deutsche “Ordnungspolitik”, die die unterschiedlichen Sphären abgrenzte und damit begrenzte, ist altmodisch in Europa.
Die Folge: Ein grandioseres Politikversagen als die Einführung des Euros kann man sich kaum vorstellen: Er funktioniert halt nicht, so lange Wirtschaft, Soziales, Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht, Wirtschaftskraft und Wirtschaftsverständnis, Finanzpolitik und Finanzverstand nicht wenigstens halbwegs harmonisiert sind in Europa: Was wirtschaftlich falsch ist, kann politisch eben nicht zurechtgebogen werden. Deshalb werden die Deutschen eben zahlen für die Fehler einer wirtschaftsfernen Politik; mit 80 Milliarden für Griechenland und mit 250 Milliarden in Form von Zinsverlusten für Lebens-, Riester- und Bausparverträgen; kurz: mit ihrer Altersversorgung. Da wird ja dann sicherlich die Süddeutsche wieder den „Kapitalismus“ bemühen, wenn der Wohlstand der Gesellschaft in Altersarmut umschlägt – nur nicht mit Fakten wird es erklärt werden, denn die stammen aus dem politischen Raum. Der arbeitet weiter mit seinem Primat. Die Kosten steigen. Ob Europa diese Lehre aus dem Griechenland-Desaster zieht? Wohl kaum. Während die Wähler dem obskuren Projekt eines europäischen Zentralstaats davon laufen, basteln seine Profiteure genau daran. Politik ist eben zu schön für die, die sie betreiben. Nicht nur in Griechenland.
Zuerst erschienen auf Tichys Einblick hier.
Den Süden sichern
1981 wurde Griechenland EG-Mitglied. Dafür gab es einen guten Grund, wie die Akten des Auswärtigen Amtes zeigen von Lukas Axiopoulos

Einsamer Fels: Blick zur Akropolis in Athen, 2010 | © Orestis Panagiotou/dpa
Griechen raus! Aus Protest gegen die Politik der schwarz-gelben Regierung in der Euro-Krise trat kürzlich der FDP-Finanzobmann Frank Schäffler zurück. Er hatte gefordert, Griechenland aus dem Euro-Raum auszuschließen. Auch Reiner Holznagel, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler, argumentierte, es sei deutschen Bürgern nicht zu vermitteln, dass dem griechischen Staat Milliardenkredite zukämen, ihnen selbst aber steuerliche Entlastungen verweigert würden: »Mehr Zumutung geht kaum!«
Ähnliche Stimmen waren vor mehr als 30 Jahren schon einmal zu hören – als über den Beitritt Griechenlands in die Europäische Union, die damals noch Europäische Gemeinschaft (EG) hieß, diskutiert wurde. Am 12. Juni 1975 hatte das Land offiziell einen Beitrittsantrag gestellt. Der damalige Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis erklärte vor den EG-Botschaftern in Athen: »Griechenland gehört zu Europa, dessen Teil es ist gemäß seiner geopolitischen Lage, durch seine Geschichte und Tradition, die der Ursprung des gemeinsamen kulturellen Erbes Ihrer Länder ist.«
Anders als bei der Nordwesterweiterung 1973, als Großbritannien, Irland und Dänemark beitraten, wollte damit erstmals ein Land in die EG, das den westeuropäischen Staaten nicht nur wirtschaftlich weit hinterherhinkte: Griechenland war auch noch keine stabile Demokratie. Von 1967 bis 1974 hatte eine Militärdiktatur den Staat beherrscht. Ebenfalls 1974 war der griechisch-türkische Streit um Zypern eskaliert, als nach einem griechischen Putsch gegen den Präsidenten der multikulturellen Insel türkische Truppen den Nordteil Zyperns besetzten. Seither ist die Insel geteilt.
In der deutschen Presse war die Skepsis gegen den Beitrittskandidaten groß. Die Erweiterung der EG um Griechenland sei »wirtschaftlich ein Unding« schrieb der Tagesspiegel. »Die Steuerzahler [müssen] mit einem erheblichen Preis für die Erweiterung rechnen«, prophezeite die Welt. Im Spiegel stand zu lesen, die EG-Unterhändler hätten ihren Dossiers entnehmen können, »was sie vorher schon hätten wissen müssen: ›Griechenland ist Italien minus Mailand‹«. Zudem wähnte man die EG ohnehin in der Krise. »Die Mitgliedschaft der Griechen erscheint in Brüssel […] so nützlich wie die Aufnahme eines Lahmen in einen Verein von Fußkranken, der um seinen Aufstieg in die erste Liga kämpft«, polemisierte die ZEIT. Doch die sozialliberale Regierung unter Helmut Schmidt und die anderen westeuropäischen Regierungen ließen sich nicht beirren: Am 1. Januar 1981 wurde Griechenland zehntes Mitglied der EG.
Die Gründe, die ausschlaggebend für die Aufnahme waren, kamen in der öffentlichen Debatte kaum zur Sprache. Nachlesen kann man sie im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin. Bereits Ende 1974 waren die Bundesministerien gebeten worden, zur Beitrittsfrage Stellung zu nehmen. Im September 1975 formulierte die Bundesregierung ihre Haltung dann so: »Eine Teilung Europas in einen Block meist größerer, politisch und wirtschaftlich bedeutender Länder und eine Gruppe kleinerer, politisch und wirtschaftlich schwächerer europäischer Nationen« müsse auf Dauer »zu ernsten Belastungen für die Beziehungen […] zu den betroffenen Staaten führen«. Gegen die EG-Mitgliedschaft Griechenlands spreche im Prinzip nichts. »Die unvermeidlichen Belastungen [sind] durch die Verhandlungsprozedur und durch geeignete Übergangslösungen« in Grenzen zu halten. »Der entscheidende Gesichtspunkt«, der es aber verbiete, »den griechischen Beitrittsantrag abzulehnen«, sei »die Unteilbarkeit des freien Europa«. Europa lasse sich nicht selektiv nach dem Kriterium der wirtschaftlichen oder außenpolitischen Opportunität einigen.
http://www.zeit.de/2010/24/Griechenland-EG-Beitritt
Dr. Oliver Marc Hartwich 02.07.2015 Achgut.com
Schuldzuweisungen innerhalb der Eurozone sind wohlfeil – aber keine Lösung
Liebe Leser, ich muss Sie um Nachsicht bitten. Seit fünf Jahren bemühe ich mich, für den Business Spectator und die Achse des Guten ausgewogene, gut recherchierte Kolumnen zu verfassen, ab und zu mit einer provokanten Aussage gewürzt. Heute – am Tag 1 nach dem griechischen Staatsbankrott – ist mir das nicht möglich. Ich bin einfach zu wütend.
Nun also, mit einer Entschuldigung an meine sehr geschätzten Herausgeber, meine Wutrede über Athen.
In der schier endlosen Eurokrise war die vergangene Woche zweifellos die bisher bizarrste. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas ähnliches je erlebt zu haben. Wir wurden Zeugen einer unfassbaren Mischung aus politischem Dilettantismus, Chuzpe und Aggressivität.
Niemand in diesem Euro-Spiel ist unschuldig. Alle Beteiligten müssen ihren Anteil an dem Desaster eingestehen und ihre Rolle in der eskalierenden Krise reflektieren.
Fangen wir mit der Ursünde der Eurokrise an. Griechenland hätte niemals in die Eurozone aufgenommen werden dürfen. Mehr noch, die Eurozone hätte es überhaupt nicht geben dürfen.
Von vornherein war der Wurm drin
Die Vorstellung, man könne völlig disparate europäische Volkswirtschaften vereinen, indem man ihnen eine Währung, einen Leitzins und einen Wechselkurs überstülpt, war nicht nur töricht, sie war wahnsinnig. Mit Volkswirtschaft hatte sie nichts zu tun, da von einem optimalen Währungsraum keine Rede sein konnte; es ging immer nur um politische Macht.
Hätte Deutschland nicht 1990 für die Wiedervereinigung der Zustimmung der Franzosen bedurft, hätten sich die Deutschen nie freiwillig von der D-Mark getrennt. Diesen Preis mussten sie dafür bezahlen, dass Frankreich einen größeren östlichen Nachbarn akzeptierte. In Frankreich glaubte man, die Einbindung Deutschlands in das Korsett einer Währungsunion würde seine Macht beschränken. Eine Fehlkalkulation kolossalen Ausmaßes.
Der nächste schwere Fehler war die Aufnahme Griechenlands in den Club. Wieder hatte die Entscheidung nichts mit Volkswirtschaft, aber alles mit Symbolik zu tun. Griechenland, die vermeintliche Wiege der Demokratie, war zwar seit Jahrhunderten volkswirtschaftlich ein Pflegefall gewesen, aber ein Europa ohne Griechenland? Nein, auch die Griechen gehörten ins Boot.
Damals mangelte es nicht an kritischen Stimmen. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff stimmte im Bundestag gegen die Aufnahme Griechenlands in die Eurozone. Er mahnte, dass Griechenland einfach nicht so weit war. Aber weder Lambsdorff noch Hunderte von VWL-Professoren, die offene Briefe gegen den Euro unterzeichneten, wurden gehört.
Von Beginn an wurden die Regeln, nach welchen die Europäische Währungsunion funktionieren sollte, nicht befolgt. Sie waren kaum das Papier wert, auf dem sie gedruckt waren. Defizit- und Verschuldungsgrenzen, das Verbot einer Staatenrettung, der Auftrag an die Europäische Zentralbank, sich nur auf Preisstabilität zu konzentrieren und dabei die Unabhängigkeit zu wahren: im Zweifelsfall galt keine dieser Regeln etwas, die Europäische Union warf sie alle über Bord. Wie um Himmels willen sollte dann Vertrauen in die Maßnahmen der EU – und erst recht in den Euro – erwachsen?
Auch die Vorgängerregierungen haben versagt
Ein gerüttelt Maß an Schuld an der Krise Griechenlands gebührt den verschiedenen Regierungen. Es waren die großen Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Parteien Griechenlands, die Geld mit vollen Händen ausgaben, Statistiken frisierten und immer neue Tricks erfanden, um heimlich noch mehr Schulden aufzunehmen. Dringend notwendige Reformen blieben auf der Strecke. Es stimmt, die gegenwärtige Syriza-Regierung ist ein Desaster. Aber man muss auch anerkennen, dass Tsipras, Varoufakis & Co ein Land übernahmen, das sich in einem Zustand heilloser Unordnung befand.
An diesem Desaster in und um Athen sind aber auch andere europäische Spitzenpolitiker schuld. Nachdem bereits 2010 offensichtlich geworden war, wie verheerend der Euro in Griechenland gewirkt hatte, war Bundeskanzlerin Angela Merkel kurzzeitig bereit, das Richtige zu tun, nämlich Griechenland aus der Eurozone hinauszuwerfen. Der Druck aus anderen europäischen Ländern und von der US-Regierung ließ sie schnell einknicken. Seitdem bekämpft die EU Schulden durch Aufnahme von noch mehr Schulden.
Das Ergebnis ist einfach zu beschreiben: Der private Sektor verabschiedete sich aus Griechenland, alle Risiken wurden an europäische Steuerzahler übertragen. Gewinne wurden privatisiert, Verluste sozialisiert. Tut mir leid, dass ich wie ein Sozialist klinge, aber so ist es nun mal geschehen.
Und was haben wir jetzt davon? Nach fünf Jahren haben die griechischen Staatsschulden nicht abgenommen, sondern zugenommen. Das Bruttoinlandsprodukt ist seit dem Höchstwert um 25 Prozent geschrumpft. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 26 Prozent. Wachstum ist nicht in Aussicht, dafür nehmen die Spannungen zwischen Griechenland und dem übrigen Europa zu.
Der IWF: eine große Enttäuschung
Die einzige gute Idee in dem ganzen Rettungsverfahren war die Hinzuziehung des Internationalen Währungsfonds. Denn der IWF weiß, wie man einem gestrauchelten Land wieder auf die Beine hilft. Unter der Führung der beiden französischen Direktoren Dominique Strauss-Kahn und Christine Lagarde spielte der IWF jedoch nicht die Rolle eines unabhängigen Schiedsrichters, sondern vertrat Partikularinteressen. Obwohl Griechenland ein kleines (und verhältnismäßig reiches) Land ist, wurde es zum größten Rettungsprojekt des IWF.
In einer Welt, deren Schwerpunkte sich immer mehr nach Asien verschieben, wurde der IWF europäischer. Er schenkte Griechenland zu viel Aufmerksamkeit und investierte viel zu viel Geld. Hätte er sich so verhalten, wenn es sich nicht um ein europäisches Land gehandelt hätte? Wenn seine Direktoren nicht frühere französische Politiker gewesen wären, hätte er dann genauso gehandelt? Die Antworten liegen auf der Hand.
Und nun zur gegenwärtigen griechischen Regierung. Was Tsipras und Varoufakis in den vergangenen Monaten abgeliefert haben, kann nur als die schlimmste Ausübung internationaler Diplomatie aller Zeiten bezeichnet werden. An einem Tag etwas ankündigen, am nächsten Tag das Gegenteil vorschlagen. Entscheidungen aus dem Weg gehen und zu wichtigen Treffen unvorbereitet erscheinen. Europäischen Nachbarn drohen und sie im gleichen Atemzug um Hilfe angehen. In Athen eine Aussage treffen, in Brüssel etwas ganz anderes sagen. Vladimir Putins Russland umschmeicheln und den IWF eine kriminelle Organisation nennen. Diese griechische Regierung – es tut mir nicht leid, das so zu sagen – ist eine der schlechtesten, die die Welt je gesehen hat.
Sogar die scheinbar demokratische Idee der griechischen Regierung, ein Referendum abzuhalten, ist reiner Zynismus. Der einzige Zweck besteht darin, mehr Zeit zu schinden. Die Frage auf dem Stimmzettel ist unverständlich. Wie auch immer die Wähler sich entscheiden, an der Position Griechenlands in Europa wird sich nichts ändern.
Damit das klar ist, ich liebe direkte Demokratie und würde gern mehr davon sehen. Vielleicht sollten wir aber nicht die Griechen befragen, ob sie ihren Kuchen aufessen und ihn behalten möchten, sondern den Deutschen die Frage stellen, ob sie für weitere griechische Kredite bürgen wollen?
Niemand hat eine weiße Weste
Wie eingangs gesagt, handelt es sich hier um eine Wutrede. An dieser Krise ist niemand schuldlos: nicht die Griechen, nicht die Deutschen, nicht die Europäische Kommission, nicht die Europäische Zentralbank und insbesondere auch nicht der Internationale Währungsfonds.
Lediglich einen Hoffnungsschimmer sehe ich. Jetzt, da der Staatsbankrott Griechenlands endgültig amtlich ist, wird vielleicht eine Lösung der Krise in Umrissen erkennbar. Wie wäre es, wenn Griechenland die Eurozone verlässt, seine neue Währung abwertet, den Staatsbankrott erklärt und sein Wirtschaftssystem reformiert? Seit fünf Jahren argumentiere ich in dieser Kolumne so, und ich bin keineswegs der einzige Volkswirtschaftler, der dies tut.
Werden die Spitzenpolitiker Europas uns endlich zuhören?
Dr. Oliver Marc Hartwich ist Executive Director der The New Zealand Initiative.
‘The eurozone must stop playing the blame game’ erschien zuerst in Business Spectator (Melbourne), 2. Juli 2015. Übersetzung aus dem Englischen von Eugene Seidel (Frankfurt am Main).
PS: Mehr dazu von mir in der Paul Henry Show und bei TV New Zealand.
Gregor Gysi
Der Prophet
In heute geradezu verblüffender Klarheit skizzierte Gregor Gysi am 23. April 1998 im Bundestag, welche Folgen die bevorstehende Euro-Einführung für Europa haben werde. Er sollte bis ins Detail Recht behalten.
An manchen Stellen glaubt man, es wäre der 1. Juli 2015 und Gregor Gysi würde seinen Redebeitrag zur Griechenland-Debatte des Bundestages halten. So zutreffend zumindest sind seine Prognosen, als ob er über jene Krise resümieren würde, die seit 2008 den gesamten Euro-Raum erfasst hat. Doch die Rede stammt vom 23.4.1998 und war Teil eines siebenstündigen Schlagabtausches im Bundestag über die Einführung des Euro als neue europäische Gemeinschaftswährung.
Dort gehörten Gysi und die PDS mit der Ablehnung des Euros ohne ausreichende politische und wirtschaftliche Integration zu einer Minderheit. Nur 35 Abgeordnete stimmten gegen das „Jahrhundertereignis“ (Kohl), davon waren 27 Angehörige der PDS-Gruppe. Damit wurde gegen den Willen der breiten Bevölkerungsmehrheit der Deutschen votiert. Neun Tage später, am 2. Mai 1998, wurde die Einführung des europäischen Bargeldes auch von den Staats- und Regierungschefs der EG beschlossen.
Doch dass die Minderheit mit ihren Warnungen in vielem Recht behalten sollte, zeigt sich nun im Kontext der nicht enden wollenden Euro-Krise. Im Rückblick wird die Währungsunion weitgehend konsensual als Geburtsfehler ausgemacht. So bleibt die Rede Gysis als ein hochaktuelles Dokument außerordentlichen politischen Weitblicks. Im folgenden der Text im Wortlaut.
Ein Kontinent ist nicht über das Geld zu einen
Dr. Gregor Gysi, Gruppe PDS, am 23.4.1998 im Deutschen Bundestag, zur Europäischen Wirtschafts-und Währungsunion
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zunächst noch ein Wort an den Abgeordneten Hans-Dietrich Genscher: Sicherlich sind die politischen Unterschiede zwischen uns beiden, aber vor allem auch zwischen der Gruppe der PDS und der Fraktion der F.D.P. und den dahinterstehenden Parteien gewaltig, insbesondere wenn ich an die Wirtschafts- und Finanzpolitik denke. Das ändert aber nichts daran, daß wir diese Gelegenheit Ihrer Abschiedsrede im Bundestag nutzen möchten, um Ihnen unseren Respekt für Ihre Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten sowohl im Bundestag als auch in der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen.
Es war hier viel die Rede von europäischer Integration. Zweifellos ist die Einigung Europas ein großes politisches Ziel. Ich erinnere mich an die Tage, als die Mauer fiel, als die Diskussion um die Herstellung der deutschen Einheit begann und als die bange Frage gestellt wurde: Was wird das nun? Wird das ein deutsches Europa, oder wird es ein europäisches Deutschland? Diese Frage hat damals nicht nur die Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker in diesem Land und in anderen Ländern bewegt, sondern viele Menschen.
Die Frage, die sich bei der heutigen Debatte ergibt, ist meines Erachtens eine andere: Wie kommt man zu einer europäischen Integration? Kommt man tatsächlich zu einer europäischen Integration, indem man ein Europa der Banken schafft? Oder käme man nicht viel eher zu einer europäischen Integration, wenn man über den Weg der Kultur, wenn man über den Weg der Chancengleichheit in den Gesellschaften, wenn man über den Weg der Angleichungsprozesse und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ein solches Europa integriert?
Das ist unsere grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben, über das es heute zu beschließen gilt. Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat in der Geschichte noch niemals funktioniert, und das wird auch hier nicht funktionieren. Sie, Herr Genscher, haben vor allem davor gewarnt, daß es schlimme Folgen hätte, wenn die Europäische Währungsunion scheiterte. Ich behaupte, sie kann auch scheitern, wenn man sie einführt, nämlich dann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen.
Darüber müßte nachgedacht und, wie ich finde, auch länger diskutiert werden. Ich sage: Im Augenblick wird das ein Europa für erfolgreiche Rüstungs- und Exportkonzerne, für Banken, vielleicht noch für große Versicherungen. Es wird kein Europa für kleine und mittelständische Unternehmen, kein Europa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Gewerkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozial Schwächsten in den Gesellschaften der Teilnehmerländer.
Wie verhält sich denn Deutschland zu diesem wirklichen europäischen Integrationsprozeß? Ist es nicht so, daß es die Union — auch unter Kritik der F.D.P. — vor kurzem abgelehnt hat, auch nur den Kindern von Eltern, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und die noch eine andere Staatsangehörigkeit haben, die deutsche Staatsangehörigkeit zu gewähren?
Wer dazu nein sagt, will doch gar keine Integration, zumindest nicht auf dieser kulturellen, auf dieser menschlichen Ebene, auf die es in diesem Zusammenhang ankäme.
Ich weise darauf hin, daß die Bundesregierung den Euro vehement gefordert und gefördert hat, es aber gleichzeitig abgelehnt hat, die Arbeitslosigkeit europapolitisch anzugehen. Von dem, der die Arbeitslosigkeit nicht europäisch bekämpfen will, behaupte ich, daß dessen Integrationswille nur auf einer Strecke ausgebildet ist, und zwar im Hinblick auf das Geld, aber nicht bezüglich der sozialen Frage, bei der dies wichtig wäre.
Wir alle wissen, daß wir es mit sehr ernstzunehmenden, auch rechtsextremistischen Erscheinungen in unserer Gesellschaft zu tun haben, daß Rassismus zunimmt, daß zum Beispiel in einem Land wie Sachsen-Anhalt das Ansehen rechtsextremistischer Parteien leider zunimmt. Das alles macht uns große Sorgen. Ich sage: Da ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, an ihre sozialen Interessen anknüpfende europäische Integrationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen Voraussetzungen betreibt, dann wird sie der Keim zu einem neuen Nationalismus und damit auch zu steigendem Rassismus sein. Das ist unsere große Sorge, die wir hier formulieren wollen.
Hier ist gesagt worden, daß es in Europa ohne Euro keinen Abbau von Arbeitslosigkeit geben werde. Das verstehe ich überhaupt nicht. Täglich wird uns erzählt, daß in bestimmten europäischen Ländern Arbeitslosigkeit durch verschiedenste Maßnahmen erfolgreich abgebaut wurde, ohne daß es den Euro gab. Ich halte es immer für gefährlich, wenn scheinbar zwingende Zusammenhänge hergestellt werden, die in Wirklichkeit nicht existieren, nur um ein anderes Ziel damit begründen und erreichen zu können.
Im Gegenteil, der Euro birgt auch sehr viele Gefahren für Arbeitsplätze, und es bringt uns gar nichts, auf diese nicht einzugehen. Der Bundeskanzler ist heute mehrmals historisch gewürdigt worden. Ich werde mich an dieser Würdigung zu Ihrem Wohle nicht beteiligen, Herr Bundeskanzler.
Ich würde mich an Ihrer Stelle nicht so sehr in der Vergangenheit definieren lassen. Das birgt ja auch Probleme. Man kann natürlich leicht den Euro einführen, wenn man sagt: Es wird eine andere Regierung sein, die ihn auszubaden hat. Das ist natürlich auch ein Problem, vor dem wir hier stehen.
Ja, unterhalten wir uns über die Voraussetzungen. Fangen wir mit den Demokratiedefiziten an, die es in Europa gibt. So haben zum Beispiel sehr viele Juristen erklärt, ob wir heute im Bundestag ja oder nein zum Euro sagten, ob der Bundesrat morgen ja oder nein zum Euro sagen werde, sei unerheblich. Er werde in jedem Falle kommen, weil dies nämlich längst mit dem Vertrag von Maastricht ratifiziert sei und im Grunde genommen kein Weg daran vorbeiführe.
Am 2. Mai tagt das Europäische Parlament. Hat es in der Frage der Einführung des Euro, in der Frage der Herstellung der Währungsunion etwas zu entscheiden? Es hat nichts zu entscheiden. Es hat nur mitzuberaten. Selbst wenn dort eine große Mehrheit nein sagen würde, würde das an der Einführung des Euro zum 1. Januar 1999 nichts mehr ändern. Da wird das gesamte Defizit deutlich, das dieser Vertrag in Fragen der Demokratie mit sich bringt.
Wir schaffen eine europäische Währung, haben aber keinen europäischen Gesetzgeber, keine europäische Verfassung, keine garantierten europäischen Rechte und verlagern die Funktionen vom Parlament auf die Exekutive in Brüssel. Das heißt, wir heben die Gewaltenteilung in der Gesellschaft schrittweise auf, damit sich dann die jeweilige Bundesregierung und auch die Regierungen der anderen Länder und deren Parlamente auf Brüssel herausreden und sagen können: Wir können in diesen Fragen gar keine nationale Politik mehr machen, weil uns die Möglichkeiten genommen sind. Aber wir haben eben kein demokratisches europäisches Äquivalent. Das ist ein Hauptmangel der Verträge von Maastricht und Amsterdam.
Ich behaupte, der Euro kann auch spalten; denn er macht die Kluft zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union und jenen, die nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, nicht kleiner, sondern größer. Der Weg gerade für die osteuropäischen Länder, für die sich Herr Genscher so eingesetzt hat, in die Europäische Union wird dadurch nicht leichter, sondern schwieriger werden. Er unterscheidet innerhalb der Mitgliedsländer der EU zwischen jenen, die an der Währungsunion teilnehmen, und jenen, die daran nicht teilnehmen. Das ist das erste Mal eine ökonomische und finanzpolitische Spaltung zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union.
Er unterscheidet aber auch und stärker die Euro-Länder. Ob Frau Matthäus-Maier, ob die Sprecherin der Grünen, ob CDU/CSU oder F.D.P., alle würdigen am Euro, daß sich die Exportchancen Deutschlands erhöhen würden. Wenn das dann so ist, dann müssen doch andere Produktionsunternehmen in anderen Ländern darunter leiden. Anders ginge es doch gar nicht.
Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhöhen und damit die Industrie in Portugal, Spanien und anderen Ländern schwächen. Die werden verostdeutscht, weil sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Europas führt. Das zweite ist: Es geht selbst innerhalb der verschiedenen Länder um unterschiedliche Regionen. Es haben doch nur die Regionen etwas davon, die in erster Linie vom Export leben. Was ist denn mit jenen Regionen auch in Deutschland, die kaum exportieren? Sie wissen, daß der Exportanteil der ostdeutschen Wirtschaft fast null ist. Sie hat überhaupt nichts davon. Im Gegenteil, die Binnenmarktstrukturen werden durch Billigprodukte und Billiglöhne systematisch zerstört werden.
Deshalb sage ich: Es ist ein Euro der Banken und der Exportkonzerne, nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auf den Binnenmarkt angewiesen sind, nicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Wir haben es mit einem weiteren Problem zu tun, nämlich dem, daß der Reichtum in diesem Europa wachsen wird, aber in immer weniger Händen liegen wird. Dafür ist Deutschland ein lebendiges Beispiel. Lassen Sie mich nur eine Zahl nennen. 1990, nach der Herstellung der deutschen Einheit, hatten wir in der Bundesrepublik Deutschland ein Sparvermögen von etwas über 3 Billionen DM. Das sind 3000 Milliarden DM. Ende 1996 hatten wir ein privates Sparvermögen von 5 Billionen DM, das heißt, von 5000 Milliarden DM.
Im Durchschnitt hat jeder Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland ein Sparguthaben von 135 000 DM. Nun können sich die Bürgerinnen und Bürger einmal ausrechnen, wie weit sie unter diesem Durchschnitt liegen. Dieser Durchschnitt kommt dadurch zustande, daß in 10 Prozent der Haushalte der Reichtum so gewachsen ist.
Da sagt doch der Herr Merz von der CDU/CSU, daß es die größte Katastrophe wäre, wenn nach einem Regierungswechsel die Reformen rückgängig gemacht würden. Was heißt denn das? Wollen Sie ein Europa, einen Euro mit immer mehr Kürzungen des Rentenniveaus? Wollen Sie ein Europa mit immer mehr Zuzahlungen für Kranke bei Medikamenten und bei ärztlichen Behandlungen? Das waren doch Ihre Reformen. Wollen Sie ein Europa, in dem 10 Prozent der Bevölkerung sinnlos immer reicher werden und andere immer mehr draufzahlen müssen? Das ist das Ziel Ihrer Politik. Ich finde, diese Reformen müssen unbedingt rückgängig gemacht werden.
Was hat denn die Vermehrung des privaten Vermögens bei 10 Prozent der Bevölkerung um 2000 Milliarden DM in sechs Jahren — das muß man sich einmal überlegen — der Wirtschaft gebracht? Welche Investitionen sind denn davon getätigt worden? Welche Arbeitsplätze wurden denn geschaffen? Weder im Osten noch im Westen hat es etwas gebracht. Der wachsende Reichtum hat nur zu noch mehr Arbeitslosen geführt. Deshalb ist das der falsche Weg nach Europa.
Mit der Demokratiefrage hängt übrigens auch zusammen, daß Finanz- und Geldpolitik kaum noch möglich sein werden. Die Zuständigkeit hierfür wird an die Europäische Zentralbank abgegeben. Sie wird dadurch anonymisiert. Damit wird erreicht, daß sich die Regierungen herausreden können, indem sie es auf die Bank schieben und erklären können, daß sie keine politischen Spielräume haben, weil die Europäische Zentralbank bestimmte Vorgaben gemacht hat. Wer so eine Politik einleitet, zerstört Demokratie, denn Auswahl haben die Menschen nur in der Politik und nicht bei der Bank. Da haben sie nicht zu entscheiden. Das ist die Realität in dieser Gesellschaft und auch in anderen europäischen Gesellschaften.
Unsere größte Kritik richtet sich aber auf einen anderen Punkt; das ist das Wichtigste: Wer europäische Integration will, muß europäische Angleichungsprozesse einleiten. Dazu würde gehören, die Steuern zu harmonisieren, die Löhne und Preise anzugleichen und auch soziale, ökologische und juristische Standards anzugleichen. Es macht ökonomisch einen großen Unterschied, ob es gegen irgend etwas ein Einspruchsrecht gibt oder nicht. In dem einen Fall ist es nämlich teurer als in dem anderen Fall.
Wenn Sie das alles politisch nicht leisten und statt dessen sagen, wir führen eine Einheitswährung ein, um die Angleichungsprozesse zu erzwingen, dann sagen Sie damit doch nichts anderes, als daß Sie ganz bewußt Lohnwettbewerb, also in Wirklichkeit Lohndumping und Kostendumping, organisieren wollen.
Den größten Vorteil hat immer derjenige mit den niedrigsten Steuern, den niedrigsten Löhnen, den niedrigsten Preisen und den niedrigsten ökologischen, juristischen und sozialen Standards; dieser wird sich durchsetzen. Das führt zu einem Europa des Dumpings, des Abbaus nach unten. Wer so etwas organisiert, der – das behaupte ich -organisiert nicht nur Sozial- und Lohnabbau, sondern er organisiert auch zunehmenden Rassismus. Das mag nicht bewußt geschehen, aber es wird die Folge sein. Heute erleben wir das schon auf den Baustellen in Deutschland und in anderen Ländern.
Deshalb sagen wir: Das ist der falsche Weg. Wir hätten hier einen anderen einschlagen müssen. Erst wenn wir die Angleichungsprozesse politisch gemeistert hätten, hätte man am Schluß der Entwicklung als Krönung eine Einheitswährung einführen können. Wer aber die Angleichung über die Währung erzwingt, der erzwingt eine Angleichung nach unten mit all ihren katastrophalen sozialen Folgen. Alle Fraktionen, die heute zustimmen, haften dann auch für die Folgen, die dadurch eintreten, unabhängig davon, welche Motive sie dabei haben.
Es ist davon gesprochen worden, daß eine Währung Frieden herstellen kann. Ich glaube das nicht. Das gilt nur, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Nämlich nur dann, wenn es gelingt, Spannungen abzubauen, ist eine Währung friedenssichernd. Wenn aber dadurch neue Spannungen entstehen, kann auch eine gegenteilige Wirkung erzielt werden. Das wissen Sie. Sie wissen, daß die einheitliche Währung in Jugoslawien keinen Krieg verhindert hat. Er war einer der schlimmsten der letzten Jahre.
Lassen Sie mich als letztes sagen: Der Hauptmakel dieser Währungsunion wird bleiben, daß Sie die deutsche Bevölkerung nicht gefragt haben. Sie hätten in dieser entscheidenden Frage einen Volksentscheid durchführen müssen. Dann hätten Sie auch Ihrer Aufklärungspflicht nachkommen müssen. Das widerspricht, Herr Kollege Merz, nicht parlamentarischer Demokratie. Auch Frankreich, Dänemark und Irland sind parlamentarische Demokratien und haben dennoch einen Volksentscheid durchgeführt. Nein, man kann das Volk nicht nur wählen lassen. In wichtigen Sachfragen muß man es auch zu Entscheidungen und zum Mitmachen aufrufen. Anders wird man Integration in Europa nicht erreichen.
http://le-bohemien.net/2015/07/03/gregor-gysi-der-prophet/
Grexit
Wie die Troika Europa ruiniert
Die Grexit-Debatte ist ein Skandal, ein Neusprech, der die fatalen Auswirkungen der Austeritätspolitik legitimieren soll. Mit der Realität hat all das nichts zu tun.
Der Artikel ist auch als Replik auf den kürzlich hier erschienen Kommentar von Dr. Klaus Funken zu lesen
Von Sebastian Müller
Immerhin die Einsicht, dass die Ursachen der Fehlentwicklungen in der EU bereits in der Gründung der Währungsunion liegen, wird mittlerweile verlautbart. Diesem Befund ist nicht nur zuzustimmen, er ist mittlerweile auch breiter Konsens. Ohne die Harmonisierung der Steuer- und Wirtschaftspolitik mit ausgeglichen Außenhandelsbilanzen in der EU war die fundamentale Krise, die weit mehr als nur eine Krise der Währungsunion ist, absehbar.
Nun steht die Frage im Raum, welche Handlungsoptionen jetzt überhaupt noch realistisch sind. Der Weg zurück in den Zustand der Währungsunion vor der Krise ist versperrt, egal wie das Drama um den drohenden Grexit letztendlich auch ausgehen sollte. Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zieht man offenbar nicht – oder aber die Falschen.
Mit unzähligen ökonomischen Drangsalierungen für das Auszahlen von Krediten, irreführenderweise „Rettungspakete“ oder „Hilfskredite“ genannt, soll die südliche Peripherie der EU wieder fit für den Wettbewerb gemacht werden. Geholfen hat das wenig. Im Falle von Griechenland waren die Kredite ohnehin nicht mehr als ein Durchlauferhitzer, die Gelder wurden umgehend an Finanzinstitute weitergeleitet. Der griechische Staat selbst erhielt von dieser „Hilfe“ nur 10 Prozent. Gleichzeitig stehen monatlich Zinstilgungen an, bis heute Mitternacht alleine 1,6 Milliarden Euro an den IWF, für die Gläubiger ein Riesengeschäft.
Von „Rettung“ also keine Spur. Deswegen wird nun eine beispiellose Geschichtskitterung betrieben: Die Eskalation der Krise soll, nachdem Griechenland unter Samaras vermeintlich die Talsohle durchschritten hatte, der vermeintlich „linksradikalen“ Syriza-Regierung verantwortet werden. Als ob angesichts der Memoranden irgendeine griechische Regierung überhaupt noch maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung ihres Landes hätte.
Der staatlich-informationsindustrielle Komplex erschafft dabei eine Mär. Die Tatsache, dass Schäuble und die Troika an dem Linksbündnis ein Exempel statuieren wollen und sich bis zuletzt in den „Verhandlungen“ unerbittlich zeigten, wird ins Gegenteil verkehrt, Regierungschef Alexis Tsipras und Finanzminister Yanis Varoufakis als verantwortungslose Spieler dargestellt. Die durchgesickerte Information, dass die Gläubiger untereinander gespalten sind, vernünftige Vorschläge der Griechen von einzelnen Parteien immer wieder abgeschmettert werden, um einen „regime-change“ zu provozieren, bleibt eine Randnotiz. Insbesondere der IWF und Schäuble lassen Tsipras am ausgestreckten Arm verhungern. Dass die Euro-Gruppe zudem nun sämtliche Zahlungen aussetzte, als Tsipras ein Referendum ankündigte, unterstreicht spätestens jetzt, dass eine ernsthafte Lösung nie gewollt war.
„Griechenland hat 1,5 Millionen. Arbeitslose, drei Millionen Arme, Tausende von Familien haben kein Einkommen und leben nur mit der Rente der Großeltern. Dies ist kein Spiel“ -Alexis Tsipras
Die beschränkte und geschichtsvergessene Debatte rund um die „Staatschuldenkrisen“ hat nichts Substanzielles anzubieten. Die Frage kreist einzig und allein um Höhe sowie Umfang der nächsten Einschnitte. Die gänzlich unhinterfragte Phrase von „Strukturreformen“ erschöpft sich seit Jahren in weiteren unsinnigen weil krisenverschärfenden Auflagen wie Mehrwertsteuererhöhung, Lohn- und Rentenkürzung sowie Privatisierungsvorgaben. Gleichzeitig hat das Ausbleiben nachhaltiger Verwaltungsreformen, welches Syriza unablässig vorgeworfen wird, tatsächlich mit dem Desinteresse der Gläubiger zu tun. Nicht zufällig soll ein umfassendes Reformprogramm für mehr Wachstum und Beschäftigung in einem deutschen Ministerium versandet sein.
Dass die SPD und ihr nahestehende Autoren zudem dieses perfide Spiel mitspielen, ist ein Offenbarungseid der Sozialdemokratie als Ganzes. Die Unfähigkeit oder der fehlender Wille, eine wirtschaftspolitische Alternative zu Merkels Europapolitik zu entwerfen, ist seit der Agenda 2010 eine weitere Etappe auf dem Weg der SPD in die politische Bedeutungslosigkeit. Soweit wie sich die SPD von einer sozialdemokratischen Partei, hat sich auch Europa entfernt von der “Vision eines vereinigten Europas, die über die graduelle Angleichung von Lebensstandards, einer Vertiefung der Demokratie und dem Erblühen einer wahren europäischen Kultur erreicht werden wird”. So schwebte es zumindest Oskar Lafontaine noch am Abend der Euroeinführung vor.
Den Eindruck, dass die katastrophalen Auswirkungen der Austeritätspolitik nicht nur hingenommen, sondern auch gewollt werden, versucht man von politischer Seite nicht einmal zu entkräften. Dazu passt ins Bild, dass Syriza für die Ablehnung der marktradikalen Schocktherapie als „radikal“ diskreditiert wird. Es ist politische Schizophrenie oder die Manipulation des Jahrzehnts, wenn nicht eine Politik der Verelendung, die zu einer Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 50 Prozent, zu steigenden Suiziden und einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems geführt haben, sondern deren Ablehnung als Radikalismus gilt.
Doch selbst mit ökonomischer und politischer Erpressung wird sich die in desolater Lage befindliche europäische Peripherie nicht zurück in die fragwürdigen, weil neoliberal determinierten Maastricht-Verträge zwängen lassen. Die allseits gehegte Befürchtung, dass die Union in Zukunft zu einer Transfer-Union werden könnte, wird spätestens dann zum Faktum, wenn sich die EU in Zukunft als föderales System mit maßgeblich eingeschränkten Souveränitäts-, sprich Haushalts- und fiskalpolitischen Rechten der Mitgliedsstaaten mit unterschiedlicher Wirtschaftsleistung entwickeln sollte. Dann nämlich wird ein funktionales Äquivalent zum bundesdeutschen Länderfinanzausgleich in der Eurozone unverzichtbar.
Doch vorerst versucht vor allem die deutsche Bundesregierung, allen voran ihr Finanzminister, diese Wahrheit zu umschiffen. Tatsächlich ist unter den gegebenen politischen Rahmenbedingungen der Preis für diese Integration hoch. So hoch, dass die aufgeworfene Frage, ob denn die Bürgerinnen und Bürger reif und bereit für einen europäischen Bundesstaat mit zumindest gemeinsamer Wirtschafts-, Fiskal-, Haushalts- und Sozialpolitik seien, genauso berechtigt ist, wie auch eine diesbezüglich pessimistische Einschätzung.
Der besagte Preis bemisst sich aber nicht in der Höhe von Transferleistungen, sondern in den Konsequenzen für Demokratie und Rechtsstaat. Warum die Bürger einen europäischen Bundesstaat mit Skepsis betrachten, ist so offensichtlich, wie die postdemokratische Entwicklung, die den bisherigen europäischen Integrationsprozess auszeichnet. Denn mit der ihr innewohnenden Übertragung nationaler Hoheitsrechte nach Brüssel werden den Bürgern sukzessive die Einflussmöglichkeiten genommen. Solange nicht auch die nationalen Demokratien ihre Entsprechung in den EU-Intitutionen finden, wird die öffentliche Zustimmung zu dem bürokratisierten und zum Teil gewaltsam daher kommenden Assimilationsprozess zu Recht nicht größer werden. Der feindselige Umgang gegenüber einer Syriza-Regierung, die zumindest um ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit im Land kämpft, folgt da einem Muster.
Der angesichts der Krise unter Hochdruck betriebene Einigungsprozess folgt also einem dystopischen Drehbuch. Defizite wie das Fehlen einer demokratischen Kontrolle der Wirtschaftspolitik haben kaum einen Platz in einer öffentlichkeitswirksamen Debatte. Stattdessen findet die Entscheidungsfindung über die Zukunft Europas in den Hinterzimmern der Brüsseler Bürokratie statt. Der Vertrag von Lissabon ist das offenkundigste Beispiel dafür, dass die europäische Integration fast ausschließlich unter Determinanten der Marktgläubigkeit vonstatten geht. Dass die Austeritätspolitik vom EU-Parlament oder den „Instutionen“, wie man die Troika neuerdings nennt, kaum hinterfragt wird, lässt erahnen, welchen Interessen dort gedient wird. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Merkels Reformverträge zur Steigerung der „Wettbewerbsfähigkeit“, sprich eine „Troika für alle„, bald Realität werden wird.
Griechenland ist nur eine Blaupause für das, was auf die Unter- und Mittelschichten in Europa zukommen wird, wenn der Widerstand der Hellenen zusammenbricht. Der Bumerang des Sozialdumpings wird unter dem Narrativ der Wettbewerbsfähigkeit auch wieder auf Deutschland zurückschlagen. Der Euro ist zum Selbstzweck, einer Illusion geworden, die die Versprechen seiner Gründer nicht mehr erfüllt. Im Gegenteil sinkt zum ersten Mal wieder der Lebensstandard der einfachen Europäer, wie Heiner Flassbeck und Costas Lapavitsas nachgewiesen haben. Und das gilt angesichts jahrelanger Lohnstagnation und einer “beggar-thy-neighbour”-Politik auch für die Deutschen.
Angesichts des mit dem „race to the bottom“ einhergehenden Generalangriffs auf die europäischen Sozialstaaten dürfen die Tendenzen einer Re-Nationalisierung kaum verwundern. Freilich ist der Weg zurück zu einem Europa souveräner Nationalstaaten wohl verbaut; doch als Alternative wird nichts angeboten als die Kritik an den Kritikern der Brüsseler Diktate. Ein Unbehagen an dem viel zu weit gehenden Einfluss der europäischen Institutionen und einem IWF, der in Europa eigentlich nichts verloren hat, wird zwar bisweilen geäußert, so die „ausschließlichen Entscheidungen im Detail“, die intransparente Kommunikation mit ihrer „irreführenden Begrifflichkeit“, die „selbst Experten“ herausfordert, ohne aber dabei zu benennen, um was es sich da handelt: Ein technokratisches Regime, das im Interesse der Finanzmärkte operiert.
Denn was sagt es in all seiner Tragweite aus, wenn man einerseits von Entscheidungen spricht, die von den Finanzmärkten „erzwungen“ wurden und im Gegenzug dann das Nicht-Einhalten dieser Zwangsverträge moniert? Es entlarvt, dass eine Politik nach demokratischem Mandat und im nationalen Interesse schlicht verwerflicher gilt, als die Abwicklung der Demokratie und ihrer instrumentellen und sozialen Grundlagen durch eben jene Technokraten.
Die Blindheit oder Verschleierung der Tatsache, dass sich hier in Wahrheit griechisches Interesse mit dem der europäischen Bürger insgesamt deckt, ist eine Bankrotterklärung unserer politischen Geisteshaltung. So ist auch das Mantra der Kürzungspolitik, die Verhöhnung der Opfer und die Delegitimierung ihrer Interessen, ja die ganze propagandistische Irreführung der wirkliche Skandal in der ganzen Grexit-Debatte. Es ist auch die wahre Ursache für den „Riss, der die Europäische Union spaltet“ und „quer durch die europäische Gemeinschaft, (…) quer durch die sozialen Schichten, ja (…) quer durch die politische Klasse selbst“ geht. Dass die Symptome zwar bisweilen erkannt, nicht aber deren Ursache benannt werden, ist die eigentliche Tragik unserer Epoche.
Update, 1.7.15:Heute Mitternacht konnte Griechenland die oben erwähnte Kreditrate von 1,55 Milliarden Euro nicht an den IWF zurückzahlen, das Land ist faktisch Zahlungsunfähig. Wann jedoch das sogenannte Kreditereignis ausgelöst wird, hängt von der IWF-Direktorin Christine Lagarde ab. Sie kann innerhalb eines Ermessensspielraums von 30 Tagen entscheiden, wann sie dem IWF-Gouverneursrat meldet, dass keine Zahlung aus Athen eingegangen ist. Theoretisch also könnte Lagarde ohne Probleme das Referendum und die politischen Reaktionen darauf abwarten.
http://le-bohemien.net/2015/06/30/grexit-wie-die-troika-europa-ruiniert/
Europa
Demokratie statt Solidarität
Ob für oder gegen Griechenland: gerne beruft man sich auf Solidarität. Das Wort erlebt in Krisenzeiten eine wahre Inflation. Dies aber vermittelt ein völlig falsches Bild. Weder war das bisherige „Hilfs“-Programm ein Akt der Solidarität, noch wird es benötigt. Was wir brauchen ist Demokratie.
Von Florian Schmitz
Selten schien man in Europa so solidarisch miteinander. Milliarden an Steuergeldern wurden aufgewandt, um die in Not geratenen Länder aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Hilfskredite, Eurorettung, Friedensnobelpreis. Die EU-Regierungen, allen voran die Kanzlerin und ihr Finanzminister, feiern die Euro-Rettung als gelungenen Erfolg. Alle seien unter den notwendigen Entbehrungen durch das tiefe Tal geschritten und endlich ginge es aufwärts. Alle außer Griechenland.
Vom Rettungsschirm zur Kapitalkontrolle
Unverständnis herrscht bei den Deutschen. Unverständnis und Wut. Hat man sich doch jahrelang solidarisch-großzügig gezeigt. Die Kanzlerin selbst hatte es immer betont: alternativlos waren die Rettungsmaßnahmen. Schnell durchgewunken im Parlament. Hilfe. Völlig unbürokratisch und – vor allem – uneigennützig. Dieser Eindruck zumindest entsteht, wenn man das (gescheiterte) Krisenmanagement Revue passieren lässt. Und nun auf einmal bocken die Griechen. Man will das Volk befragen. Das solidarische Herz zerbricht in tausend Stücke.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist das vermeintliche Hilfsprogramm ausgelaufen. Ein Programm, das vorsah, „Hilfs“-Kredite (ein Kredit ist per Definition keine Hilfsleistung) an ein völlig bankrottes Land zu zahlen, nur, um sich das Geld dann direkt wieder auszahlen zu lassen. Das muss man erst einmal verstehen. Und jetzt wird die Lage brenzlig in Hellas. Schon wieder.
Die Luft auf den Straßen ist zum schneiden. Schlangen vor jedem noch funktionierenden Geldautomat. Nur 50 Euro dürfen täglich pro griechischem Konto abgehoben werden (für Ausländer gilt das nicht). Viele Menschen haben keine Bankkarte und sind von der Geldversorgung abgeschlossen. Kapitalkontrolle. Ausnahmezustand. Und in Deutschland spalten sich – abgesehen von den vielen Indifferenten – die Lager: Die einen sprechen von „Solidarität jetzt erst recht.“ Die anderen, darunter auch die deutsche Bundesregierung, meinen, die Grenzen der Solidarität seien erreicht.
Besser verhandeln als solidarisieren
Dabei wird es Zeit, den heiligen Solidarschein auszuknipsen und endlich am Tisch der Fakten einzukehren. Ein Fakt beispielsweise ist, dass die „Angebote“ der EU an Griechenland nach den kräftezehrenden Monaten ewig dauernder Verhandlungen einfach nicht annehmbar sind.
Mehrwertsteuererhöhung? In einem Land, in dem diese bereits über dem europäischen Durchschnitt liegt und in dem der Binnenmarkt quasi kollabiert ist? In einem Land, in dem der Mindestlohn 3,35 Euro beträgt und mehr als ein Viertel der Bevölkerung keine Arbeit hat? Und: Unternehmenssteuer erhöhen? In einem Land, in dem ein Unternehmen nach dem anderen Konkurs anmeldet und das dringend auf Investoren aus dem Ausland hofft?
Man muss kein Experte sein, um zu verstehen, dass solcherlei Forderungen genau das verhindern, was – laut Aussage der selbsternannten Euro-Retter – das Kernziel der Hilfsprogramme war: Wachstum. Ganz sicher kann man sagen: In Griechenland hat das Programm nicht „geholfen.“ Und – gegensätzlich zu offiziellen Aussagen: Auch in den anderen Ländern bleibt die große helfende Wirkung aus.
Griechenland hat Probleme, ist aber keins
Weder in Spanien, noch in Portugal hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wesentlich gebessert. Die konservativen Regierungen dort sprechen von Erfolgen, doch sie warten nur darauf, abgewählt zu werden. Polen (noch kein Euro-Land) ist eine der am stärksten wachsenden Wirtschaftsmächte Europas – und erlebt gerade die größte Auswanderungswelle seit dem 2. Weltkrieg. In Deutschland siedelt der paritätische Wohlfahrtsverband die Armutsquote auf 15,5 % an. Überall in Europa brodelt es, doch scheint dies durch die mediale Einkesselung Griechenlands niemandem so richtig aufzufallen.
Lieber zeigt man sich solidarisch mit dem isolierten schwarzen Schaf, als sich darüber bewusst zu werden, dass die Krise kein Problem á la Hellas ist und sich auch über dessen Grenzen hinaus nicht in Luft aufgelöst hat. Doch mit der medialen Lupe über einem Land, das bereits lange bankrott ist, wirkt die Situation vor der Haustür schon viel besser. Solange man sich auf die Griechen konzentriert und so tut, als hätten die Probleme dort nichts zu tun mit den zahllosen Problemen der EU, wiegt man sich in Sicherheit.
Solidarisch ja – aber nicht mit Tsipras
Auffällig ist, wie solidarisch die EU mit dem Vorgänger von Ministerpräsident Alexis Tsipras war. In der Zusammenarbeit mit der Samaras-Regierung gab es keine Beanstandungen. Man sprach von den Reformbemühungen Griechenlands und den guten Fortschritten. Da schüttelte man sich solidarisch die Hand, während das Wachstum ausblieb. Fakt hier ist: Die Vorgänger-Regierung unter Samaras hat nicht eine einzige sinnvolle Reform durchgeführt. Nicht eine einzige.
Es sind Steuern auf Kinder erhoben worden, weil diese als Luxus gelten und Luxus erfordert nun mal Geld. Als Freiberufler zahlt man ab dem nullten Euro Steuern, denn bereits wenn man sich bei einer Innung oder Berufsvereinigung registriert, kassiert der Staat monatlich Steuern für nicht verdientes Geld. Die Samaras-Regierung hat gegen geltendes Recht verstoßen, Strandgrundstücke zum Verkauf angeboten und den Staatssender vom Netz genommen. Weder das Steuersystem ist reformiert, noch sind Steuerflucht und Korruption bekämpft worden.
Da aber war Europa solidarisch genug, alle Augen zuzudrücken. Erst als Tsipras kam, samt seinem Finanzminister, wurde man kritisch. Beide sind jetzt die auserkorenen Unsolidarischen im vereinten Europa. Dass die Forderungen der EU ihrem Land den Todesstoß versetzt hätten, spielt dabei keine Rolle. Von den einen als unverschämte Lausbuben oder auch gefährlichste Männer Europas verschrien, werden sie von anderen als Helden zelebriert.
Fakt ist ebenfalls: Auch die Syriza-Regierung ist die notwendigen Reformen bis dato nicht angegangen. Und anstelle von blinder Solidarität wären die europaweit vielen Anhänger besser beraten, der neuen Regierung kritisch über die Schulter zu schauen. Den Staatssender haben sie wieder aufgemacht und bieten den Austeritäts-Institutionen Paroli. Doch leider haben sich die Hoffnungen, Varoufakis würde einen genialen Plan zur Steuerreform aus der Schublade ziehen und beginnen, mit dem elenden Korruptionschaos in Griechenland endlich aufzuräumen, nicht erfüllt. Egal ob „Nai“ oder „Oxi“ – das Land muss endlich seine Probleme angehen.
Ja und Nein zu was denn nun?
In dieser Stimmung nun lässt Tsipras die Griechen abstimmen. Ein notwendiges Referendum, das unter einem schlechten Stern steht. Technisch gesehen geht es nur darum, das „Angebot“ der EU (das sie ja mittlerweile wieder zurückgezogen hat) anzuerkennen (Ja) oder abzulehnen (Nein). Durch die verhärteten Fronten aber zwischen der griechischen Regierung und der EU wird die Abstimmung gewertet als ein Bekenntnis für oder gegen Europa (so etwa, wie das Referendum, das derzeit in Österreich vorbereitet wird).
Für die Griechen bedeutet dies zu wählen zwischen: „Ja, ich entscheide mich für ein „Hilfs“-Programm, das dem Land bisher jede Möglichkeit zur wirtschaftlichen Erholung verwehrt hat und einen Staatenbund, der das eigene Scheitern nicht anerkennt.“ und „Nein, wir riskieren den Austritt aus der Währungsunion und somit wirtschaftliche Isolation, mit einer Regierung, die als großer Hoffnungsträger bisher untätig geblieben ist.“ Die Menschen, die zu einem „Ja“ tendieren fürchten sich davor, den Euro zu verlieren. Sie fühlen sich sicherer mit der gemeinsamen Währung und als Mitglied der EU. Die anderen, die zum „Nein“ tendieren, sind erschöpft vom Spardiktat. Die letzten Jahre unsäglicher Stagnation lasten stärker, als die Angst vor der Isolation.
Nun warten alle auf Sonntag. Die Börsen reagieren positiv auf jede kleine Annäherung und negativ auf jeden Streitpunkt. Und ein Volk, dem eine Woche lang kein oder nur geringer Zugang zum Restkapital gegeben wurde, soll an den Urnen über sein Schicksal entscheiden. Keine Idealvoraussetzungen für eine demokratische Abstimmung – vor allem deswegen nicht, weil sich die letzten Wochen alles andere als demokratiefreundlich gezeigt haben.
Griechenland und die EU
Nein, sehr demokratieaffin haben sich die „Institutionen“ bzw. hat sich Europa gegenüber den Griechen wirklich nicht gegeben. Schon bei Tsipras‘ Wahlsieg hatte Frau Merkel keine guten Worte für ihren frischgebackenen Amtskollegen. Die angeblichen Verhandlungen hatten dann mit einer Auseinandersetzung auf Augenhöhe ebenfalls wenig zu tun. Vielmehr haben sich die vorher so solidarischen „Geber“-Länder nach dem Regierungswechsel in Athen schlichtweg geweigert, eine umfassende Manöverkritik hinsichtlich der Sparpolitik anzugehen – vor allem auf Druck der Bundesrepublik.
Mit anderen Worten: Griechenland hatte zu keinem Zeitpunkt eine Chance, die Verhandlungspartner von ihrem Standpunkt abzubringen. Denn dann hätte Europa Fehler zugeben müssen. Da aber hört die Solidarität auf. Das Ergebnis ist jenes Angebot, über das am Sonntag abgestimmt werden soll. Ein Angebot, das in fast jedem Detail dem gleicht, was vor den Verhandlungen galt.
Staatenbund vs. Nationalstaat
In all dieser Panik um Griechenland und mit all dem verletzten Solidaritäts-Stolz vergisst man wie immer das Wesentliche: Es wird Zeit, sich auf ganz Europa zu konzentrieren. Der Staatenbund befindet sich auf einem schlechten Kurs und die Re-Nationalisierung der Mitgliedsländer ist die Folge. Anti-Europa Bewegungen jenseits der rechten Mitte sind gesellschaftsfähig geworden – sind ein Teil unseres Alltags. Flüchtlinge verelenden dies- und jenseits der EU-Grenzen. Ganze Länder werden geopfert. Das ist das Gegenteil von Solidarität. Das ist eine Verkennung der prekären Lage in ganz Europa.
Das größte Versagen de EU in diesem Kontext liegt genau dort, wo auch der griechische Staat bisher untätig geblieben ist. Die Aufgabe einer regierenden Verwaltung ist es, Strukturen zu schaffen, innerhalb derer ein soziales Konstrukt am Leben erhalten werden und sich entwickeln kann. Brüssel muss funktionierende Kanäle zwischen den einzelnen Nationalstaaten schaffen, die es den Bürgern ermöglicht, Arbeitsplätze zu schaffen und die vielen Ressourcen Europas sinnvoll zu nutzen. Gerade der Wissenstransfer sollte hier im Vordergrund stehen.
Mehr EU, aber mit Betonung auf Union
Alles jedoch, womit die EU bisher in Verbindung gebracht wird, ist das Scheitern eines Hilfsprogramms, das über Jahre den tatsächlichen Status quo Griechenlands einfach überdeckt hat. Würde die EU aber Strukturen schaffen, die den Bürgern ein freies Handeln ermöglicht, und Hilfsmittel, mit denen dieses unterstützt würde, wäre das kommende Referendum ein für alle tragfähiges Instrument der Demokratie.
Unter diesen Umständen aber laufen wir Gefahr, die Idee Europa aufzugeben aufgrund der fehlenden Flexibilität innerhalb einer gescheiterten Rettungsmission.
In einer Demokratie ist es legitim, Fehler zu machen. Das System sieht dafür Entscheidungsmechanismen vor. Ausführende Personen müssen für falsches Handeln die Verantwortung übernehmen – als Staatsbedienstete. In jedem Falle sind sie per Eid und Grundgesetz dazu verpflichtet, zum Wohle des Volkes zu entscheiden. Beharren sie auf fehlerhaftem Handeln, nur um die eigene Position zu sichern, ist das mehr als nur unsolidarisch. Es ist gegen ihren Eid.
Florian Schmitz lebt und arbeitet in Griechenland als freier Korrespondent und Autor. Als überzeugter Europäer widmet er sich auf seinem Blog EUdyssee.net Aspekten des europäischen Lebens, die in Zeiten der Krise oft nicht genug Beachtung finden.
http://le-bohemien.net/2015/07/04/europa-demokratie-statt-solidaritaet/
Zwei Stimmen zu Griechenland (2)
Die Entdemokratisierung Europas
Die EU ist zu einem supranationalen Monstrum aus Technokratie und Exekutivföderalismus geworden, das nicht nur alle Bemühungen um Demokratisierung ad absurdum, sondern auch vor Augen führt, was droht, wenn man sich gegen die diktierte Version vom richtigen Wirtschaften stellt.
Von Christian Volk
Die Konfliktparteien in der griechischen Schuldenkrise scheinen buchstäblich „die Sache gegen die Wand gefahren zu haben“ – und mit „der Sache“ ist hier nicht nur der Staatsbankrot Griechenlands gemeint, sondern mittelfristig auch die Europäische Union gleich selbst. Denn was sich hier als die Eurogruppe plus (ehemalig) Troika etabliert, ist ein supranationales Monstrum aus Technokratie und Exekutivföderalismus, das nicht nur alle zaghaften institutionellen und vertraglich festgehaltenen (!!!) Bemühungen um Demokratisierung der EU seit Monaten vollständig ad absurdum führt, sondern auch vielen anderen Gesellschaften innerhalb der EU vor Augen führt, was ihnen droht, wenn sie sich gegen die mit „neu-deutscher Robustheit“ (Habermas) diktierte, gegenwärtig Staats- und Regierungschefs übergreifende Version vom richtigen Wirtschaften stellen.
Sowohl als spanischer oder portugiesischer Bürger als auch als Anhänger einer demokratischen EU kann einem hier nur Angst und Bange werden. Ein solches Regieren in Europa ist extrem gefährlich. Sollte die griechische Regierung wirklich die vorgesehenen Reformauflagen (siehe ‘list of prior actions‘) akzeptieren, könnten sie das griechische Parlament für die nächsten Jahre schließen. Der Gestaltungsspielraum in zentralen Politikfelder wäre dann nämlich gleich null – von der Mehrwertsteuer über die finanz- und strukturpolitischen Maßnahmen, die Rentenreform, die Neustrukturierung der öffentlichen Verwaltung ist sprichwörtlich bis auf den Prozentpunkt alles vorgegeben. Und, das sei hier angemerkt, lediglich um dieses Hilfspaket zu verlängern. Weitere werden folgen müssen, die sicher nicht weniger detailliert den politischen Gestaltungsspielraum von Parlament und Regierung einschränken würden.
Die paternalistischen Analogien vom „Hausaufgaben-Machen“, vom „Einsehen, dass man über die eigenen Verhältnisse gelebt habe“ sind ebenfalls Teil einer Entmündigungsstrategie. Neben der Tatsache, dass solche Analogien den politischen Gegner infantilisieren, verweisen sie auf einen Mangel an politischer Urteilskraft. Die griechische Regierung vertritt eine Position, für die sie von den griechischen Wählern legitimiert worden ist – und für die sie, wenn am Samstag Referendum ist, eine gnadenlose Mehrheit bekommen wird. Diese Position mag den deutschen und restlichen Verhandlungsführern nicht passen – und das teils sogar mit guten Gründen. Auch ist das Auftreten der Regierung um Tsipras grenzwertig bis naiv – das von manchem Verhandlungsführer auf der Gegenseite ist jedoch nicht weniger fragwürdig. Aber darum darf es im Kern in einer so brisanten Lage nicht gehen − und es geht auch nicht darum.
Was hier auf der europäischen Bühne exerziert werden soll, ist ein ökonomischer Weltanschauungsstreit. Statt die Frage im Blick zu halten, wie die Schuldenkrise Griechenlands so gelöst werden könne, dass sie dort nicht zu weiteren sozialen Verwüstungen (50% Jugendarbeitslosigkeit etc.) führt, dass sie Griechenland ein Zukunftsperspektive bietet und dass sie die politisch-institutionelle Krise der EU nicht noch weiter verschärft, wird hier ein Exempel statuiert: Marktkonformität im Konsolidierungsstaat oder raus! Wer so agiert, wird in der Tat „in der Mülltonne der Geschichte enden“ (Piketty), denn er opfert nicht nur alle Bemühungen einer nachhaltigen Demokratisierung der supranationalen Ebene dem Dogma der Marktkonformität, sondern in eklatanter Weise auch die parlamentarische Demokratie Griechenlands.
Dabei ist es doch völlig offensichtlich, dass man den griechischen Staat weder zur Rückzahlung der Schulden verdonnern noch ihm weitere Sparmaßnahmen abverlangen kann. Beides ist nicht möglich und wird auch nicht passieren. Rentenkürzungen vor dem Hintergrund des griechischen „Sozialsystems“ (ein System ohne Arbeitslosenversicherung) ist ein staatlich verordnetes Pauperismus-Programm. Keine griechische Regierung – heute oder in Zukunft – kann ein solches Programm umsetzen, ohne dass sie aus dem Land gejagt wird. Politik hat immer auch etwas mit dem Anerkennen von Realitäten zu tun – und in gleicher Weise wie etliche Forderungen und Bestrebungen von Syriza unrealistisch sind und waren, so sind auch diese Forderungen schlicht unrealistisch – mögliches Investitionsprogramm hin oder her.
Was als Beobachter des ganzen Schauspiels schließlich in besonderer Weise frustriert, ist die geringe Anteilnahme, die Gleichgültigkeit innerhalb der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gegenüber den Konsequenzen einer von Deutschland maßgeblich dominierten Politik in Griechenland – gepaart mit dem Mangel an Verständnis für die Folgen, die diese Geschichte für die Zukunft Europas haben wird. Wie bestimmte Zeitungen und Medien die „Jetzt reicht es“-Rhetorik zelebrieren und die Tatsache abfeiern, dass jetzt sogar Sigmar Gabriel „entsetzt“ sei, hat mit ernsthaften und kritischem Journalismus überhaupt nichts mehr tun. Getoppt wird das Ganze nur noch vom geschichtsvergessenen Chauvinismus des deutschsprachigen Boulevard in dieser Angelegenheit. Er suggeriert, dass sich hierzulande jeder und jede den „faulen Griechen“ überlegen fühlen darf – als ob die Tatsache, dass er, sie oder ich einen Arbeitsplatz haben, in erster Linie von unseren individuellen Qualitäten abhinge. Wir könnten unser Glück ja mal in Griechenland versuchen!
Christian Volk ist Juniorprofessur für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Trier. Sein Kommentar über die Zukunft Griechenlands ist Teil einer Debatte mit Bernd Ladwig, dessen Replik Sie hier lesen können.
Beide Texte stehen unter einer CC-BY-SA-Lizenz und erschienen ursprünglich auf dem Theorieblog.
http://le-bohemien.net/2015/07/02/die-entdemokratisierung-europas/
Hier erkläre ich zum letzten Mal die Ursachen und Zusammenhänge der sogenannten „Euro-Krise“und die maßgebende Rolle der korrupten und gierigen Deutschen bei der Ruinierung Griechenlands und anderer Staaten zum Zwecke der Bereicherung der deutschen Bankster.
Und wenn ich dann immer noch von jemanden „die korrupten (und/oder faulen) Griechen“ als Ursache der sog. Euro-Krise, fälschlicherweise „Griechenlands-Krise“ gennant bekomme, dann werde ich rabiat, whatever it means.
Und da die meisten von Ihnen nur noch Bildchen verstehen, habe ich als Erklärung ein Bildchen gemacht. Hier ist es:
Die Deutschen
Relevanter Faktor
Merkel zitiert sich selber, und niemand riskiert einen Zwischenruf.
Von Henryk M. Broder Die Weltwoche, Ausgabe 27/2015 weltwoche.ch
Es kommt nicht oft vor, dass die Kanzlerin zu einer Aussage Stellung nimmt, die sie früher gemacht hat, sich also selbst interpretiert. Nun ist es passiert. Auf einem Festakt zum 70. Jahrestag der Gründung der CDU sagte sie, es komme heute darauf an, sich die «Fähigkeit zum Finden von Kompromissen» zu bewahren, denn: «Wenn diese Fähigkeit [. . .] verlorengeht, dann ist Europa verloren. Und in diesem Sinne ist auch der Satz zu verstehen, den ich schon des Öfteren gesagt habe: ‹Scheitert der Euro, scheitert Europa.› Und deshalb muss um diese Grundsätze gekämpft werden, wir könnten sie kurzfristig vielleicht aufgeben, wir könnten vielleicht sagen: Geben wir einfach mal nach. Aber ich sage, mittel- und langfristig werden wir damit Schaden nehmen, wir werden Schaden nehmen dahingehend, dass wir kein relevanter Faktor mehr in der Welt sind, dass wir keine Gemeinsamkeit mehr haben, und deshalb müssen wir für Kompromissfähigkeit und Grundsätze in Europa wieder und immer wieder werben, meine Damen und Herren.»
Die Damen und Herren nahmen das Statement mit höflichem Beifall auf. Niemand riskierte einen Zwischenruf, keiner stand auf und sagte: «Mit Verlaub, Frau Kanzlerin, Sie reden Unsinn.» Die Klarstellung war, wie man in Wien sagen würde, eine «Verschlimmbesserung». Zum einen muss jeder, der einen Kompromiss eingehen will, Grundsätze aufgeben, man kann nicht die Stellung halten und sich zugleich bewegen. Zum anderen wurden, um Europa beziehungsweise die EU zu retten, alle Grundsätze, auf die man sich anfangs verständigt hatte, über Bord geworfen: dass es keine Transferunion geben, dass kein Staat für die Schulden eines anderen haften, dass die Europäische Zentralbank keine Staatsfinanzierung durch den Ankauf wertloser Anleihen betreiben würde. All das ist passiert, im Widerspruch zu allen Verträgen und Versprechungen. Und nun kommt die Kanzlerin daher und sagt, um Grundsätze müsse gekämpft werden, damit die Fähigkeit zum Finden von Kompromissen nicht verlorengeht. Damit wir ein relevanter Faktor in der Welt bleiben. So etwa hat es einer ihrer Vorgänger gemeint, als er im Jahre 1897 im Reichstag sagte: «Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.»
http://www.weltwoche.ch/index.php?id=554402
Die Fakten über Griechenland und der deutsche Qualitätsjournalismus
Dass die Mehrheit der deutschen Medien in Sachen Griechenland total von der ideologischen Rolle sind, muss man fast nicht mehr erwähnen. Unsere Leser überschütten uns Tag für Tag mit Hinweisen auf tendenziöse, ideologische und sogar hetzerische Beiträge.
Besonders dreist fälschen naturgemäß kurz vor dem Referendum die Zeitungen, die sich seit Beginn des Jahres dem Kampf gegen SYRIZA verschrieben haben. Ich will heute nur auf ein besonders krasses Beispiel hinweisen, obwohl wir schon einige Male in diesem Fall die Fakten richtig präsentiert hatten (zum Beispiel hier und hier).
In der FAZ schreibt Rainer Hermann, Redakteur in der Politikredaktion, über die „griechische Krise in Zahlen“: „Griechenland war im zweiten Halbjahr 2014 auf gutem Weg. Zuvor war in den sechs Jahren seit dem Ausbruch der Krise das Bruttoinlandsprodukt um ein Viertel geschrumpft, im dritten Quartal 2014 wuchs es aber erstmals wieder um 1,7 Prozent.“ Das vierte Quartal, in dem die griechische Wirtschaft wieder geschrumpft ist, hat er natürlich ebenso „übersehen“ wie die Tatsache, dass auch vorher nichts auf gutem Weg war.
Und weiter: „Die damalige griechische Regierung und die Gläubiger waren zuversichtlich, dass die Talsohle durchschritten sei. Für 2015 prognostizierten sie ein Wachstum von 2,9 Prozent. Die politische Unsicherheit, die im Dezember 2014 einsetzte und im Januar zu Neuwahlen führte, zeigten indes, wie fragil die Erholung war. Dabei war das Geschäftsklima bis Anfang 2015 so gut wie viele Jahre nicht.“ Zum einen verwendet er eine Prognose der Gläubiger als Beweis (von denen wir wissen, wie falsch sie in der Regel sind, siehe hier), zum andern haben wir (hier) gezeigt, dass das Geschäftsklima nichts mit der tatsächlichen Entwicklung in Griechenland zu tun hat.
Weiter: „Vor allem kleine und mittelständische Betriebe setzten auf Wachstum; sie stellten Arbeitnehmer ihre ein, so dass im Winter die Arbeitslosenquote von 27 auf 25 Prozent zurückging. Die Industrieproduktion stieg bis zum Februar…“. Das ist besonders dreist, weil die Industrieproduktion nur im Februar kurz stieg (das war allerdings schon unter der Regierung Tsipras, siehe unten) und der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in Zeiten, wo sich sonst wirtschaftlich nichts verbessert, einfach Ausdruck nachlassender Hoffnung der Menschen, dass sie einen Arbeitsplatz finden, folglich melden sie sich nicht mehr arbeitslos.
Die Industrieproduktion will ich noch einmal gesondert und größer als sonst bei uns üblich zeigen. Die Abbildung zeigt sonnenklar, dass bis Januar 2015 von einer Aufwärtsbewegung in keiner Weise die Rede sein kann. Im Dezember 2014 und im Januar 2015 war mit 87 (bei diesem Index 2010=100) der gleiche Wert erreicht, um den herum auch schon Anfang 2014 die Industrieproduktion schwankte und der auch im Juli schon einmal genau erreicht war. Eine Aufwärtsbewegung gab es im Februar und im März (bis auf 90), aber im April fiel die Produktion schon wieder auf den Wert 88 zurück.
Angesichts dieser Entwicklung zu sagen, bis Februar sei die Industrieproduktion gestiegen, ist eine glatte und gravierende Verdrehung der Tatsachen. Nur im Februar und im März stieg die Industrieproduktion. Das könnte man glatt, in der Art der Faktenverdrehung der FAZ, als SYRIZA-Aufschwung darstellen, denn offenbar herrschte Aufbruchsstimmung in dem Land. Aber das ist natürlich auch Unsinn. Die ganze Entwicklung, so wie sie sich über diesen Zeitraum darstellt, ist insgesamt nur als Stagnation zu interpretieren. Jedes hineindeuteln von konjunkturellen Entwicklungen ist Kaffeesatzleserei. Fest steht nur, dass es keine Anzeichen dafür gibt, weder vor noch nach SYRIZA, dass Griechenland aus der Talsohle entkommen könnte.
Die deutschen „Qualitätsmedien“ beklagen mehr und mehr, dass ihnen das Internet das Wasser abgräbt. Außerdem wehren sie sich mit Händen und Füßen gegen die Kritik an ihrem ideologischen und demagogischen Vorgehen und bestreiten vehement, was einfach nicht zu bestreiten ist. Auf wunderbare Weise hat die Satiresendung extra 3 vom NDR das gerade am Beispiel von Sigmund Gottlieb vom Bayrischen Rundfunk gezeigt (hier zu finden).
In einem Verteidigungsstück der üblichen Art schrieb Götz Hamann in der ZEIT, es würden in den traditionellen Medien „… mehr investigative Reporter beschäftigt denn je, und viele Reportagen verbinden mittlerweile faktenreichen Journalismus mit einer wunderbaren Sprache.“ Na wunderbar, dann ist ja alles gut. Erstaunlich ist nur, dass in dem Stück der ZEIT einerseits nur die traditionellen Medien erwähnt werden und dagegen wird schlicht die große Masse der überwiegend anonymen Kommentare im Internet gestellt. Dass es im Internet inzwischen Qualitätsinformation und Analyse gibt, die in ihrer Objektivität und ihrer Klarheit von den traditionellen Medien niemals erreicht wird, davon ist natürlich überhaupt nicht die Rede. Es ist das alte Spiel: Man sucht sich einen Strohmann und drischt tüchtig auf ihn ein, weil man genau weiß, dass man dem Leser nicht erklären kann, wieso analytische Schwäche und Manipulation von Fakten inzwischen zu einem Charakteristikum der deutschen „Qualitätsmedien“ geworden sind.
Noch eine Anmerkung zur FAZ und ihrem Qualitätsjournalismus
Ein Kollege weist mich gerade darauf hin, dass in dem FAZ-Artikel auch die Wachstumszahl für das dritte Quartal falsch ist. Im dritten Quartal 2014 stieg das saisonbereinigte reale BIP in Griechenland gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent und nicht – wie im FAZ-Artikel behauptet – um 1,7 Prozent (siehe hier:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6870827/2-09062015-AP-DE.pdf/aaf2b898-0ee5-4986-93f7-150c9732036a ). Aber so genau kommt es ja offensichtlich nicht – Hauptsache ist doch, dass wieder das gewünschte Ziel der Manipulation der Leser erreicht wurde.
http://www.flassbeck-economics.de/noch-eine-anmerkung-zur-faz-und-ihrem-qualitaetsjournalismus/
Alex Feuerherdt 07.07.2015 achgut.com
Mythos Wirtschaftswunder und die Schulden der Griechen
Einer der hartnäckigsten politischen (und ökonomischen) Mythen in Deutschland ist zweifellos der vom »Wirtschaftswunder« nach dem Zweiten Weltkrieg. Im kollektiven Gedächtnis der Deutschen wird der unerwartete ökonomische Aufschwung in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts gerne damit (v)erklärt, dass die Bevölkerung sich nach dem erzwungenen Ende des »Dritten Reiches«, durch das ihr Land zu großen Teilen in Trümmer gelegt worden sei, brav und fleißig an die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten gemacht und so im Schweiße ihres Angesichts »die Wirtschaft« wieder in Schwung gebracht habe, was verdientermaßen in erklecklichen Wohlstand gemündet sei.
Vergessen wird dabei vor allem eines: dass dieser Wohlstand nicht zuletzt »auf der kontinuierlichen Verwertung von Profiten aus dem Nationalsozialismus« beruhte, wie Jörg Rensmann im 2003 erschienenen Buch »The Final Insult« schrieb.* »Man halluzinierte sich«, so der Politikwissenschaftler weiter, »ein ›Wirtschaftswunder‹, dessen materielle Grundlage gleichzeitig verdrängt wurde, nämlich die Profite aus ›Arisierung‹ und Zwangsarbeit«. Hinzu kommt, dass 80 bis 85 Prozent der Produktionsanlagen intakt geblieben waren und die Gesamtkapazität jene der Vorkriegszeit weiterhin übertraf. Man kann also nicht sagen, dass Vernichtungskrieg und Holocaust sich gerächt hätten, schon gar nicht in puncto Prosperität.
Zumal da noch das Londoner Schuldenabkommen von 1953 war, mit dem 65 Staaten – darunter Griechenland – der Bundesrepublik einen Großteil ihrer Verbindlichkeiten erließen und so erheblich zum ökonomischen Aufstieg Westdeutschlands beitrugen. Es ging dabei um die Vorkriegslast – größtenteils nicht geleistete Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg – und um die Nachkriegsschulden, bei denen es sich vor allem um Zahlungen aus dem Marshall-Plan und um alliierte Kredite für Wirtschaftshilfe unmittelbar nach dem Krieg handelte.
Trotz des Verzichts der Gläubigerstaaten auf entgangene Zinszahlungen ab 1934 ergab sich eine Gesamtschuld von rund 30 Milliarden Mark, bei einer westdeutschen Wirtschaftsleistung von 70 Milliarden Mark. »Unmöglich zu erfüllen«, befand der deutsche Verhandlungsleiter Hermann Josef Abs, der während des Nationalsozialismus im Vorstand der Deutschen Bank mit der »Arisierung« von Unternehmen und Geldinstituten, die Juden gehörten, beauftragt war. Die Gläubiger reduzierten die deutschen Auslandsverbindlichkeiten schließlich um über 50 Prozent, senkten die Zinsen massiv und streckten die Schulden bis zum Jahr 1988.
Der Erlass wurde nicht von der Umsetzung von Austeritätsprogrammen abhängig gemacht, sondern sah wachstumsfördernde Maßnahmen vor. Deutschland sollte die Rückzahlungen aus seinen Exporteinnahmen decken können und nicht durch die Aufnahme neuer Schulden.
Kein Bestandteil des Londoner Abkommens waren die Reparationen für die von Deutschland besetzten Länder. Diese Zahlungen sollten nach einer deutschen Wiedervereinigung in einem Friedensvertrag geregelt werden, sie wurden also gestundet. Auch die millionenschweren Zwangskredite, die das Deutsche Reich dem besetzten Griechenland abgepresst hatte, um damit vor allem den Krieg im östlichen Mittelmeer zu finanzieren, standen nicht zur Debatte.
Hagen Fleischer, Historiker an der Universität Athen, bezeichnet die deutsche Besatzung in Griechenland als »eindeutig die blutigste von allen nicht-slawischen Ländern«. In einem Beitrag des ARD-Magazins Kontraste bilanzierte er: »Weit über 30.000 exekutierte Zivilisten, darunter auch viele Frauen und Kinder. Systematisch zerstörte Infrastruktur und Wirtschaft. Plünderorgien, vom Raubbau in den Bergwerken, die für die deutsche Seite interessant war, bis hin zum Abtransport von Olivenöl und von Lebensmitteln. Und daraus resultierten die mindestens 100.000 Hungertoten vom ersten Besatzungswinter.«
Als die Mauer fiel, standen die deutschen Kriegsschulden wieder auf der Agenda. Doch die Bundesregierung wollte sich vor Reparationszahlungen unbedingt drücken. Außenminister Hans-Dietrich Genscher habe deshalb »sämtlichen Botschaften ein geheimes Rundschreiben zugeschickt, wie man die jetzt vermutlich aufkommenden Entschädigungsansprüche abwimmeln sollte«, sagt Historiker Fleischer. In diesem Schreiben hieß es unter anderem: »Kommt es nicht zu Verhandlungen über einen formellen Friedensvertrag, so könnten wir darlegen, dass sich […] keine Notwendigkeit ergibt, die Frage der Reparationen aufzugreifen.«
Also gab es offiziell keinen Friedens-, sondern einen »Zwei-plus-Vier-Vertrag« zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den großen Siegermächten, in dem kein Wort über Entschädigungen und Zwangskredite verloren wurde. Griechenland durfte nicht mitreden und war darüber begreiflicherweise alles andere als begeistert. In einer diplomatischen Note forderte die griechische Regierung deshalb im Jahr 1995 Verhandlungen über die Rückzahlung der Zwangsanleihe, wurde aber mit den Worten abgekanzelt, »nach Ablauf von 50 Jahren nach Kriegsende« habe »die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren«. Heute sagt Vizekanzler Sigmar Gabriel: »Wir haben eine klare rechtliche Antwort auf solche Forderungen, nämlich, dass die spätestens mit den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen und den Ergebnissen alle diese Themen rechtlich beendet worden sind.«
Jetzt, wo die »Wiedergutwerdung der Deutschen« (Eike Geisel) abgeschlossen und die Geschichte zur Strecke gebracht worden ist, tönt es wieder laut und gnadenlos in Richtung der Griechen. Faul, frech und fordernd seien sie, hört und liest man allenthalben, auf »unser« sauer verdientes Geld hätten diese Pleitiers es abgesehen, und die hierzulande qua Selbstläuterung vorbildlich bewältigte Vergangenheit wollten sie auch nicht ruhen lassen. Der Boulevard fordert die »Eiserne Kanzlerin«, während ARD und ZDF die Frage stellen, ob der Grieche überhaupt wusste, worüber er da beim Referendum am Sonntag abgestimmt hat.
Die Großkotzigkeit und Überheblichkeit, der völlige Mangel an Empathie und das absichtsvolle Beschweigen derjenigen politischen und ökonomischen Krisengründe, die von Deutschland und der EU zu verantworten sind und nicht von Griechenland, stehen dabei hinsichtlich ihrer Widerwärtigkeit in harter Konkurrenz zu einer Geschichtsvergessenheit, die Ihresgleichen sucht. Nur allzu berechtigt ist es deshalb, dass sich die Griechen in aller Form gegen die nassforschen Töne aus einem Land verwahren, dessen Wiederaufstieg auch auf ungesühnten Verbrechen an der griechischen Bevölkerung, eiskalten Zahlungsverweigerungen gegenüber Griechenland und großzügigen Schuldenerlassen basiert. Und wer sich über Tsipras und Varoufakis ereifert, aber über Abs nicht (mehr) reden will, möge ohnehin am besten ganz schweigen.
* Jörg Rensmann: Anmerkungen zur Geschichte der deutschen Nichtentschädigung, in: gruppe offene rechnungen (Hg.): The Final Insult. Das Diktat gegen die Überlebenden. Deutsche Erinnerungsabwehr und Nichtentschädigung der NS-Sklavenarbeit, Münster 2003, S. 45-70 (S. 55).
Zuerst erschienen auf der Seite https://www.fischundfleisch.com
Burdas Focus: So geht Lügenpresse
Im Tonfall einpeitschender Kriegsberichterstattung überwunden geglaubter Zeiten „berichtet“ das angebliche Nachrichtenmagazin Focus von der Rede des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras im EU-Parlament und der Gegenrede des deutschen Abgeordneten Manfred Weber. Fakten! Fakten? Fehlanzeige!
Im Video des Focus wird so über den Event berichtet:
„Dann kommt EU-Parlamentarier Manfred Weber. Der Deutsche geht den griechischen Staatsmann mit harten Worten an. Es folgt ein Tumult im Parlament: Minutenlanger Applaus brandet auf, andere Abgeordnete halten Plakate mit der Aufschrift „No“ hoch, es kommt zu scharfen Zwischen- und Buhrufen.“
Doch Weber ist ein Deutscher und als solcher sicherlich zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl:
„Unbeeindruckt holt Weber zum finalen Schlag gegen Tsipras aus. Doch Tsipras sitzt nur da und lächelt.“
Ende des Videos.
Was dem deutschen Focus-Publikum auf diese Weise verborgen bleibt: Tsipras saß keinesfalls nur da und lächelte. Er hielt eine weitere Rede, in der er auf Webers Vorwürfe antwortete. Aber das konnte Focus nicht berichten, denn sonst hätte das schöne, kriegerische Bild von dem finalen Schlag, mit dem der aufrechte Teutone den dümmlich lächelnden Südländer niederstreckt, nicht mehr gestimmt.
Tsipras erwiderte:
„Und Ihnen, Herr Weber, möchte ich in Erinnerung rufen, dass der stärkste Moment der Solidarität der modernen europäischen Geschichte 1953 war, als unser Land nach zwei Weltkriegen völlig überschuldet und geplündert war und Europa und die europäischen Völker bei der Londoner Konferenz 1953 die maximale Solidarität zeigten, als sie die Streichung von 60% der Verschuldung Deutschlands sowie auch eine Wachstumsklausel beschlossen. Dies war der signifikanteste Augenblick der Solidarität in der modernen europäischen Geschichte.“
Ups.
http://norberthaering.de/de/27-german/news/433-luegenpresse-focus#weiterlesen
Die Griechen erinnern die EU daran, wie undemokratisch sie ist.
Wolfgang Koydl Die Weltwoche, Ausgabe 28/2015
Die erste Presseerklärung der EU-Kommission nach dem griechischen Referendum fiel aus zwei Gründen aus dem Rahmen: Zum Ersten, weil sie ausser im üblichen Englisch und Französisch auch auf Griechisch abgefasst war. Zum Zweiten, weil sie diesen bemerkenswerten Satz enthielt: «EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker berät sich mit den demokratisch gewählten Führern der anderen achtzehn Mitglieder der Euro-Zone.»
Mit anderen Worten: Die höchste Behörde des historischen Friedens-Wohlstands-Freiheits-Demokratie-Projektes Europäische Union fühlte sich bemüssigt, daran zu erinnern, dass die Präsidenten, Premiers und Kanzler westeuropäischer Staaten – Tusch und Trommelwirbel! – demokratisch gewählt worden seien. Chapeau, wer hätte das gedacht.
Sehr selbstbewusst tönte das nicht, eher nach ziemlich vielen Selbstzweifeln. Diese hatten die Griechen gesät. Ihre Volksabstimmung, so prahlten sie in einer Nachhilfestunde in Altgriechisch, sei die einzig wahre, echte Demokratie, weil hier der demos – das Volk – wirklich einmal herrschen (kratein) durfte. Kurz gesagt: «Unsere Demokratie ist besser als eure.»
Nun war das griechische Referendum weniger eine Übung in Basisdemokratie als in Zynismus. Mit der gnädig gewährten und kurzfristig anberaumten Abstimmung wollte sich die Regierung Tsipras vor ihrer Verantwortung drücken und hinter ihren Wählern verstecken. Doch solche Überlegungen entwerten nicht grundsätzlich das demokratische Instrument des Referendums.
Tatsächlich haben die Griechen in eine wunde Stelle gestochen, was Europas Eliten schmerzte und zusammenzucken liess. Denn immer mehr EU-Bürger fragen nach der demokratischen Legitimität ihrer Politiker und Institutionen: Die Euro-Zone? In keinem EU-Vertrag vorgesehen, geschweige denn kodifiziert oder kontrolliert. Die Europäische Zentralbank? Niemandem rechenschaftspflichtig. Der EU-Rat der 28 Mitgliedsstaaten? Reduziert sich auf Angela Merkel und François Hollande, wobei das französische Feigenblatt kaum mehr den nackten deutschen Machtanspruch zu verhüllen mag. EU-Chef Juncker? Von keinem einzigen EU-Bürger gewählt, noch nicht einmal daheim in Luxemburg.
Das ist die Realität. Die dünne Tünche demokratischer Lippenbekenntnisse kann sie immer weniger verdecken.
Die Deutschen
Merkels EU
Die Kanzlerin macht gewagte Aussagen zur Souveränität.
Henryk M. Broder Die Weltwoche, Ausgabe 28/2015
Oops! She did it again!» Letzten Montag, nach ihrem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Hollande, trat Angela Merkel vor die wartende Presse, um eine Erklärung zur Lage abzugeben. Dabei sagte sie unter anderem: «Wir haben eine geteilte Souveränität, weil wir eine gemeinsame Währung haben.» Eine Woche zuvor, bei einem Festakt zum 70. Geburtstag der CDU, rief sie ihren Freunden zu: «Der Euro ist mehr als eine Währung, er gründet sich auf gemeinschaftliches Vertrauen.»
Dazwischen lag das Referendum in Griechenland und eine Hitzewelle, wie sie Deutschland lange nicht mehr erlebt hatte. Je klarer wird, dass der Euro als gemeinsame Währung für 19 verschiedene Ökonomien so viel taugt wie eine Medizin für 19 Patienten, die über alle Abteilungen einer Klinik verteilt liegen, umso intensiver werden die Versuche, ihn zu einer Art Zaubertrank zu erklären, der alle Leiden heilt. Wie kann eine Währung «mehr als eine Währung» sein? Der Franc, die DM, der Gulden, die Drachme hatten eine Geschichte, der Euro ist eine fixe Idee, dazu erdacht, eine «europäische Identität» herzustellen. «One size fits all», ebenso gut könnte man alle Europäer dazu verpflichten, nur noch Genever zu trinken oder Polenta zu essen.
Wenn die Kanzlerin nun sagt, wir hätten eine geteilte Souveränität, «weil wir eine gemeinsame Währung haben», dann ist auch das mehr als gewagt. Die EU – bzw. die Euro-Zone – ist kein Bundesstaat, nicht einmal ein Staatenbund, die «Vereinigten Staaten von Europa» existieren nur in der Fantasie einiger Überflieger.
Die Kommission ist keine Regierung, die Kommissare sind keine Minister, das Parlament ist ein Plenum, in dem nur einer etwas zu sagen hat, nämlich der umtriebige Präsident des Hauses. Das einzige demokratisch legitimierte Organ ist der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs der EU. Die Staaten haben einige Kompetenzen an die EU übertragen, ihre Souveränität aber behalten. Von einer «Teilung der Souveränität» ist in keinem Abkommen die Rede. Das wäre schon deswegen absurd, weil dann die Euro-Staaten innerhalb der EU einen Sonderstatus hätten. Aber was redet man nicht so alles, wenn es heiss ist und einem das Wasser bis zum Hals steht.
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2015-28/die-deutschen-merkels-eu-die-weltwoche-ausgabe-282015.html
90% der griechischen Kredite gingen an Banken
Was uns die Politiker und Medien kaum erzählen, 90 Prozent der Zahlungen, die Griechenland vom IWF, der EU und der EZB als Kredit bekommen hat, also 242,48 Milliarden Euro, gingen direkt zu den Banken, um sie zu retten. Am meisten an französische und deutsche Banken. Nur 10 Prozent des Geldes kam direkt bei der griechischen Bevölkerung und Volkswirtschaft an. Deshalb, es ist völlig richtig, das Griechenland sich weigert diese Schulden zurückzuzahlen. Der IWF, die EU und die EZB hätten von Anfang an das Geld gar nicht geben dürfen, denn diese kriminelle Organisationen wussten, 90 Prozent wird für die Rettung von europäischen Finanzinstitute verwendet und ist nicht für den Aufbau Griechenlands gedacht.
Ist doch logisch, wieso soll der griechische Steuerzahler für Geld haften, das nie in Griechenland angekommen ist? Damals 2010 waren Privatbanken die Hauptgläubiger der griechischen Schulden. Sie hatten Kredite vergeben und sind damit das Risiko eingegangen. Mit den ganzen sogenannten Rettungsaktionen liegen heute 78 Prozent der Schulden aber bei den Ländern der Eurozone. Hier wurde die Haftung und das Risiko von Privat auf die Öffentlichkeit, bzw. auf die Steuerzahler umgeschichtet. Was hier ablief war eine höchst kriminelle Aktion der Finanzmafia.
In den meisten westlichen Staaten steht im Strafgesetzbuch, Kredite zu überhöhten Bedingungen (Wucher) oder an Leute zu vergeben, die dadurch überschuldet werden, ist illegal. Ausserdem, Verträge die unter Ausnützung einer Notlage entstehen, also durch Erpressung oder Nötigung, sind ungültig und die Handlungen strafbar. Auch Übervorteilung ist verboten. Aber genau darum handelt es sich im Verhältnis zwischen Griechenland und den Geldgebern, sei es Privatbanken, IWF, EU und EZB. Diese kriminelle Vereinigung hat Griechenland auf das schlimmste betrogen und über den Tisch gezogen. Es handelt sich also um „Odious Debt“.
Wem schuldet Griechenland die insgesamt 323 Milliarden Euro?
– 60% der Eurozone, also 141,8 Mia dem Europäischen Stabilitätsfonds und 52,9 Mia der Greek Loan Facility
– 10% dem Internationalen Währungsfonds (IWF)
– 6% der Europäischen Zentralbank (EZB)
– 3% griechischen Banken
– 1% ausländischen Banken
– 1% griechischen Zentralbank
– 15% sonstigen Inhabern von Staatsanleihen
– 3% sonstige Kredite
Quelle: Open Europe
Deshalb gibt es nur einen Weg, die griechische Regierung muss die Schulden als „illegal“ bezeichnen und jede Rückzahlung verweigern. Nur eine Streichung der Schulden wird das Land aus dieser dramatischen Krise führen. Wenn der Westen dann kein neues Geld mehr gibt, Griechenland aus der EU und Eurozone rausschmeisst, muss Athen die Drachme einführen und für neue Kredite sich nach Osten wenden, nach Russland und China. Speziell Peking ist bereit Griechenland zu helfen. Die Chinesen sind auch die einzigen, die es von der Finanzstärke her wirklich tun können.
Deshalb, am Sonntag sollten die Griechen Nein sagen. Ein Nein bedeutet, eine schwerzhafte Durchquerung einer Talsohle, mit folgenden Aufstieg in eine positive Zukunft. Ein Ja bedeutet, weniger Schmerzen aber dafür keine Aussicht jemals auf eine Erholung und Befreiung aus der Versklavung.
Griechenland in den deutschen Medien
Rolf Bossart 13. Juli 2015 http://www.theoriekritik.ch
In den Schlagzeilen deutscher Medienerzeugnisse zu Griechenland ist seit Monaten ein neues deutsches Selbstverständnis abzulesen. Das Ausmass der allgemeinen Niedertracht im Griechen-Bashing hätte aber vor der Krise niemand für möglich gehalten. Nachdem am Sonntag die Gespräche, die man in einer eigentlichen Katastropheneuphorie mit Countdown und Liveticker zum Showdown hochstilisiert hatte, abgebrochen und das Referendum angekündigt wurde, gab es für die Deutschen Blätter kein Halten mehr. Die Frankfurter Sonntagszeitung druckte eine halbe Titelseite gross das Wort: „Exodos“ in griechischen Buchstaben und eröffnete den Wirtschaftsteil mit „Das Ende“. Die Welt am Sonntag kombinierte die Häme mit Zynismus: „Game over?“ stand auf der Titelseite und darunter: „Eine Pleite Griechenlands ist kaum noch aufzuhalten. Die Bundesregierung denkt über humanitäre Hilfe nach.“ Zwei in diesem Zusammenhang schier unglaubliche Sätze, die – das muss man anerkennen – in kürzester Form den Irrwitz neoliberaler Krisenbewältigung zusammenfassen. Anstatt Schulden, an denen man jahrelang verdient hat, substantiell zu streichen und die Griechen davon zu befreien, die nächsten Jahrzehnte für das Wohl der ausländischen Banken zu arbeiten, bleibt man hart, wartet bis die staatliche Destabilisierung auf diese oder jene Weise manifest wird und wirft dann die Hilfsindustrie an, mit der, wie man heute weiss, sich ebenfalls nochmals gut verdienen lässt.
Im Feuilleton der Frankfurter Sonntagszeitung fragte Mark Siemons ganz naiv, wieso eigentlich der „Machtfaktor Deutschland“ in der ganzen Griechenland-Krise bisher so unauffällig und zurückhaltend geblieben sei. Fragte, um zu antworten, dass es gefährlich sei, das weiterhin zu tun, und rief Herfried Münkler, einen der Vordenker des neuen deutschen hegemonialen Bewusstseins zum Zeugen. Münkler glaubt nämlich in seinem jüngsten Buch, dass die blutige Geschichte, die er euphemistisch „historische Verwundbarkeit“ nennt, Deutschlands Führungsrolle in Europa besonders akzeptabel mache, da es zu besonderer Verantwortung und Sorgfalt verpflichtet sei.
Auf der Meinungsseite gab Michael Martens dann gleich noch ein Beispiel, wie man sich die deutsche Sorgfalt aufgrund der eigenen Geschichte in etwa vorstellen muss. Unter dem Titel: „Syrizas Legende vom Dolchstoss“ kommentierte er Tsipras Ankündigung, auf die Erpressung der Gläubiger mit „Demokratie“ zu antworten: „Die klassische Demokratie war, soweit wir heute wissen, eine Erfindung des antiken Griechenlands. Doch den modernen Parlamentarismus musste Griechenland aus dem Westen importieren – wie so vieles andere.“
Was soll man sagen zu solchen Kommentaren aus einem Land, dessen Bevölkerung sich erst nach zwei verlorenen Weltkriegen den „modernen Parlamentarismus“ – wider Willen – hat aufzwingen lassen?
Brüssel, Tag zwei nach der Rettung Griechenlands, und alles ist so wie immer. Überall in Europa scheint die Sonne, aber über der belgischen Hauptstadt lastet eine dunkle Wolkendecke. Penetranter feiner Sprühregen rieselt herab. Er legt sich wie klebriger, feuchter Staub auf die Menschen, die im Europaviertel zwischen der Rue de la Loi und der Place du Luxembourg unter Schirmen und im Trenchcoat ihren Büros zustreben.
Ein Werktag wie jeder andere. Nichts erinnert an die dramatischen Tage und vor allem Nächte der letzten Wochen mit ihren Dauerkrisen-Treffen und Not-Gipfeln. Die Staats- und Regierungschefs haben die EU-Metropole wieder verlassen, zweifellos mit kaum unterdrückten erleichterten Seufzern, dass sie diese Stadt fürs Erste nicht mehr so schnell wiedersehen werden. Höchste Zeit auch für Frau Merkel, Herrn Renzi und Monsieur Hollande, langsam die Ferien zu planen, die ihnen die lästigen Hellenen um ein Haar vermasselt hätten.
Nur die Finanzminister der Euro-Zone sind im tristen Brüssel geblieben, um letzte Einzelheiten jener Rettungsaktion festzuklopfen, die für den Geretteten wohl eher wirkt, als ob man seinen Kopf erst recht unter Wasser drücken würde. Vier Tage am Stück hat der deutsche Minister Wolfgang Schäuble nun schon in Brüssel zugebracht. Das gab’s noch nie, und das hat ihn, wenn schon nicht für Athen, so doch für die belgische Kapitale milde gestimmt: Recht schön sei es hier, liess sich der ansonsten beinharte Zyniker entlocken.
Jeder rügt jeden
Über die Schönheiten der europäischen Idee äusserte sich Schäuble wohlweislich nicht. Da hätte er auch nicht viel zu sagen, denn dieses Projekt liegt am Boden. Es ist ein Scherbenhaufen, eine Ruine, ein dissonanter Chor, in dem jeder jeden rügt, beschimpft und demütigt. Alle reden von Griechenland als dem kranken Mann Europas, dabei ist Europa selbst der Notfallpatient. Die Union liegt auf der Intensivstation, aber Politiker und Bürokraten tun unverdrossen weiter so, als ob der Patient genesen könnte, wenn man seine Krankheit nur hartnäckig genug negierte.
«Wir sind dazu verdammt, uns weiter durchzuwursteln, es gibt keine Alternative», meint ein hoher Eurokrat, dessen Schreibtisch sehr nahe am Zentrum einer mächtigen EU-Institution steht. Er kommt aus einem der sechs Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, und er hat sich sein Leben lang mit Europa und seinen Institutionen beschäftigt, Papiere verfasst, Vorschläge eingereicht, Rückschläge erlitten. Seinen Namen möchte er, wie viele Gesprächspartner in diesen Tagen in Brüssel, nicht in der Zeitung lesen. Das kann, im derzeit so aufgeheizten Klima, schnell die Karriere entgleisen lassen. Im Schutze der Anonymität sprechen sie dafür offener und ehrlicher als sonst.
Zerstritten, erschöpft, rat- und mutlos präsentieren sich Europas Führer. Nord giftelt gegen Süd, der Osten versteht den Westen nicht, jeder denkt zuerst an sich – sei es beim Geld, bei der Abwehr von Migranten oder beim Graben von neuen Steuerschlupflöchern. Einig sind sich die meisten lediglich im Misstrauen gegen die Deutschen. An ihrem Wesen, so die Ängste, soll diesmal vielleicht nicht die Welt, aber doch wenigstens Europa genesen. Nach «Grexit» und «Brexit» macht eine neue Wortschöpfung die Runde: «Deuropa», der germanisierte Kontinent.
Aber nicht nur die Mitgliedstaaten liegen sich in den Haaren. Der Zwist hat auch die Brüsseler Institutionen und ihre Chefs erfasst. Normalerweise sollte zwischen Kommission, Rat und Parlament ein fruchtbares Spannungsverhältnis herrschen. Nicht checks and balances wie in der amerikanischen Verfassung zwischen Weissem Haus, Kongress und Oberstem Gericht. Das wäre denn doch ein allzu vermessener Wunsch. Aber ein gegenseitiges Kontroll- und Konkurrenzverhältnis wäre doch auch schon was.
Die Realität freilich sieht so trübe aus wie der Himmel über Brüssel. Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Parlamentspräsident Martin Schulz haben sich gegen den Sprecher der Mitgliedstaaten, den Polen Donald Tusk, verbündet. Der Deutsche und der Luxemburger kungeln bei gemeinsamen lauschigen Abendessen den künftigen Kurs der EU aus und sticheln gegen Tusk. «Einer der Präsidenten macht seine Arbeit nicht ordentlich», giftelte Schulz kürzlich. «Tusk schwimmt, der hat sein Amt überhaupt nicht im Griff», tuschelt man in der Kommission. Im Ratsgebäude hat man jegliche vornehme Zurückhaltung ebenfalls längst aufgegeben. Über Junckers Alkoholproblem wird dort ebenso offen geredet wie über das «sehr unkooperative Verhalten» des Luxemburger «Sonnenkönigs».
Schulz wiederum verspottet man wegen seiner Eitelkeit: «Der will doch nur zu jedem Gipfel eingeladen werden», ätzte ein Vertrauensmann im Ratsgebäude. Sogar bei seinen eigenen Parlamentariern gerät Schulz wegen seiner Selbstgefälligkeit immer stärker in die Kritik. Selbstherrlich manipuliert er die Tagesordnung, setzt Abstimmungen eigenmächtig ab – zuweilen, um seinem Freund Juncker Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ein Vorwurf anderer Abgeordneter muss den Parlamentschef noch schmerzhafter treffen: jener der nationalen Engstirnigkeit. Schliesslich geriert gerade er sich als Gralshüter des erhabenen europäischen Gedankens. Aber es ist nun einmal so, dass Schulz immer mehr redet wie ein deutscher Politiker. Während der Griechenland-Krise tönte er mitunter wie ein besonders hässlicher Deutscher.
Selbst in der Ökonomie, einst die grosse Erfolgsgeschichte der Union, läuft es nicht mehr rund: Die globale Konkurrenz ist jünger, innovativer, fleissiger, und vor allem bürdet sie sich nicht derart astronomische Sozialausgaben wie die EU-Länder auf. So kommt es, wie es kommen muss: Vor acht Jahren trug die EU noch 31 Prozent zur Weltwirtschaft bei, heute sind es 22 Prozent. Vor acht Jahren übertraf Europas Wirtschaft jene der USA um 20 Prozent, heute ist sie kleiner als die amerikanische. Die Folgen dieses Abstiegs lassen sich konkret besichtigen: Europa ist ein Magnet für ungelernte Arbeitskräfte aus Schwarzafrika und dem Nahen Osten. Gutausgebildete Fachkräfte und Jungakademiker aus Asien ziehen die USA vor.
So also präsentiert sich das grösste Friedens-, Wohlstands- und Einigungsprojekt der Nachkriegsgeschichte. Wie sich die Zeiten geändert haben. Es ist noch nicht lange her, da hegte Europa hochfliegende Träume von sich selbst als globaler Macht. In einer austarierten, multipolaren Welt wäre es ein zivilisiertes, demokratisches Gegengewicht zum autoritären China und zu Wladimir Putins Russland. Es wäre eine mässigende, mahnende, erwachsene Stimme im Ohr der ungestümen, ungebildeten und unreifen Vereinigten Staaten.
Zu feige für die Flucht nach vorne
Dieser Traum ist vorerst ausgeträumt: In Peking, Moskau, Washington und anderen Hauptstädten verfolgt man das europäische Trauerspiel mit einer Mischung aus Verwunderung, Häme, Sorge und schadenfroher Vorfreude, wie man die Brüsseler Dilettantentruppe bei der nächsten Krise wird vorführen können. Immerhin ein paar Europäer mitsamt ihrer Aussenbeauftragten Federica Mogherini konnten sich dieser Tage parallel zu den griechischen Verrenkungen noch einmal als «Weltmächte» aufspielen. Doch in Wirklichkeit waren Briten, Franzosen und Deutsche beim Wiener Atom-Deal mit dem Iran nicht viel mehr als schmückendes Beiwerk. Signora Mogherini durfte mit dem Glöckchen die Redezeiten zuteilen.
Vielsagend illustrierte denn auch die jüngste Ausgabe der Zeitschrift Brussels Times mit einer Karikatur den Machtverlust der Europäer. Sie zeigt einen Boxring, in dem der Europäer groggy in den Seilen hängt. Um seinen Kopf tanzen die zwölf Euro-Sterne. Uncle Sam und ein russischer Bär stehen mit Boxhandschuhen vor ihm und betrachten ihn verwundert. Fragt der Amerikaner den Russen: «Wer soll ihm sagen, dass der Kampf noch gar nicht begonnen hat?»
Zum Kämpfen freilich fehlt den Europäern alles: der Mut, die Einigkeit, aber auch alleine schon die Mittel und Möglichkeiten. «Was jetzt notwendig wäre, ist politisch nie und nimmer durchzusetzen», bringt ein osteuropäischer Diplomat das Dilemma auf den Punkt. «Und was machbar ist, lässt sich nur ohne demokratische Mitwirkung durchpauken und untergräbt die Glaubwürdigkeit der EU und ihrer Führer noch mehr.»
Was notwendig wäre, weiss jeder, aber die meisten sind zu feige, um es laut auszusprechen: Eine Flucht nach vorne müsste es sein, mehr Integration, mehr Europa, mehr Souveränitätsverlust der Nationalstaaten. «Wir müssen den Bürgern wieder den Glauben an Europa zurückgeben», fordert der Diplomat, «sie müssen wieder sehen, dass Europa für sie da ist und nicht für Banken und Konzerne.» Geschieht das nicht, so meint er, «werden uns die Bürger noch schneller davonlaufen als jetzt schon». Dann beginnt er mit einer Aufzählung jener Staaten, in denen eurokritische politische Kräfte von links bis rechts im Wachsen sind. Nach einem halben Dutzend gibt er resigniert auf. «Es ginge schneller, jene aufzuzählen, in denen es solche Parteien noch nicht gibt. Da fällt mir auf Anhieb eigentlich nur Luxemburg ein, aber ich könnte nicht die Hand dafür ins Feuer legen.»
Doch die EU tut, was sie schon immer tat: Sie nimmt Veränderungen klammheimlich vor, ohne die Parlamente oder gar die Völker zu belästigen. Die «normative Kraft des Faktischen» nennt das der Brüsseler Bürokrat, «Fakten schaffen, der Rest ergibt sich hoffentlich von alleine». Auf diese Weise hat man eine ganze Reihe von Einrichtungen geschaffen, die in einem rechtsfreien Raum schweben. Die bedeutendste dieser Institutionen ist die Euro-Gruppe, die auf keinerlei legalen Grundlage beruht. Aufschlussreich, was Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis dazu berichtete. Als man ihn von einem Treffen der Euro-Gruppe ausschliessen wollte, habe er protestiert: Die Euro-Gruppe müsse einstimmig entscheiden. Daraufhin wurden Juristen befragt. Ihre Antwort: Die Euro-Gruppe existiert rechtlich nicht, also gebe es keine entsprechenden Regeln. Nun wird ein Vorschlag diskutiert, ob der Gruppe ein permanenter Präsident und womöglich eine eigene parlamentarische Versammlung beigesellt werden soll – ebenfalls rechtsfrei. Europas Architektur – ein Sammelsurium aus Schwarzbauten.
Fragt man den EU-Beamten, ob es nicht gerade dieses verstohlene Vorgehen sei, das jegliches Vertrauen der europäischen Bürger in ihre europäischen Institutionen zerstört habe, antwortet er mit einem Achselzucken. «Schon richtig», soll das heissen, «aber haben Sie eine andere Idee?»
Die hat in der Tat niemand, am wenigsten die fünf Präsidenten, die dieser Union vorstehen. Juncker, Schulz, Tusk, Dijsselbloem und Zentralbankchef Mario Draghi haben kürzlich – mit verdächtig wenig Pomp und im Windschatten der Euro-Krise – einen gemeinsamen Be- richt über die Grundzüge einer vertieften Wirtschafts- und Währungsunion vorgestellt. Dringt man durch das luftige Wörter-Popcorn zum Kern durch, erkennt man die ehrgeizige Vision einer Staatengemeinschaft, die fast alles gemeinsam beschliesst: Steuern, Haushalte, Wirtschaftspolitik.
Bolide mit angezogener Handbremse
So kühn, ja tollkühn klingt das, dass man sich an einen feurigen Lamborghini erinnert fühlt, dessen Gaspedal bis zum Boden durchgedrückt wird, damit der Motor animalisch aufheult. Nur dass der Bolide leider nicht vom Fleck kommt, weil der Fahrer die Handbremse angezogen hat. Das sei Absicht, sagt der Eurokrat aus dem Zentrum der Macht. Man sollte ihm besser Glauben schenken, denn schliesslich hat er an dem Report mitgewirkt. «Man darf die Bremse nicht lösen», mahnt er. «Das wäre viel zu gefährlich, in der EU können wir uns nicht schnell vorwärtsbewegen.» Daher schlagen auch die Präsidenten die bewährte Methode vor: Absprachen unter dem Tisch und unter dem Radar der Öffentlichkeit zu treffen. In einer «ersten Phase», versteht sich. Über Phase zwei zerbricht man sich erst später den Kopf.
Wenn es überhaupt so weit kommt. Denn bis dahin droht nach dem «Grexit» der «Brexit», ein Ausscheiden Grossbritanniens aus der Europäischen Union. Die Chancen, dass eine Mehrheit der Briten dem Kontinent den Rücken kehrt, sind angesichts des griechisch-europäischen Trauerspiels in den vergangenen Wochen und Monaten eindeutig gestiegen. Und auch der «Grexit» ist noch lange nicht vom Tisch. Gerade eben erst hat Schäuble diese Variante erneut ins Spiel gebracht: verharmlosend als Auszeit von einigen Jahren getarnt.
Damit düpierte er François Hollande, der sich damit gebrüstet hatte, während des brutalen nächtlichen Verhandlungsmarathons am vergangenen Sonntag diesen Atomsprengsatz des Griechenland-Deals entschärft zu haben. Die Aufregung des Franzosen war verständlich, denn mit seiner Bemerkung legte Schäuble – mit dem Einverständnis der Kanzlerin und des sozialdemokratischen Vizekanzlers – die Axt an eine der heiligsten Grundlagen des europäischen Projekts: den unverbrüchlichen Schwur, für immer und ewig zusammenzustehen und kein Mitglied zu diskriminieren oder gar vor die Türe zu setzen. So sakrosankt ist diese ungeschriebene Regel, dass sich ein Prinzip wie die Personenfreizügigkeit daneben ausnimmt wie eine unverbindliche Verabredung auf eine Zigarette.
Wenn ausgerechnet die Deutschen lässig die Möglichkeit eines – wenn auch nur vorübergehenden – Ausscheidens in den Raum stellen, dann haben sie damit, so die Befürchtung in Brüssel und in anderen europäischen Hauptstädten, eine Pandora-Büchse geöffnet. «Demütigend und falsch» seien solche Äusserungen, schimpfte Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann. «Das würde bedeuten, dass man jedem Land befehlen könnte, für ein halbes Jahr oder ein Jahr hinauszugehen.» Was er nicht sagte, aber sicher dachte: Die Marschorder käme immer aus Berlin.
Rolf Bossart, geb. 1970, Dr. theol., ist Publizist, Lehrer für Religionswissenschaft, Psychologie und Pädagogik. Er ist Mitarbeiter beim International Institute of Political Murder und Redaktor bei theoriekritik.ch.
«Wir wurden reingelegt» | Die Weltwoche, Ausgabe 30/2015

«Es ist genau so, wie man es befürchtet hat»: griechischer Ex-Finanzminister Varoufakis.Illustration: Birgit Schössow
Er hat die europäische Diplomatie vor sich hergetrieben, Minister und EU-Granden bis zur Weissglut genervt. Yanis Varoufakis, 54, griechischer Kommunist, Wirtschaftsminister im Knitterhemd und stets ohne Krawatte gab Rätsel auf. Was war sein Plan? Welches seine Taktik? Was würde der Meister der Spieltheorie als nächstes aushecken? «James Dean der europäischen Linken» nannten ihn die Medien. Die New York Times verglich sein Verhalten mit dem des Rebellen in «…denn sie wissen nicht, was sie tun.», der sich mit Rivalen im tollkühnen Rennen (chicken run) duelliert, wobei es gilt, in gestohlenen Autos auf eine Klippe zuzurasen: Wer zuerst aus dem Wagen springt, hat verloren.
Entsprechend atmete Brüssel durch, als der Plagegeist nach dem griechischen Referendum zum Sparprogramm das Handtuch warf, den Helm aufsetzte und auf seinem Motorrad davonbrauste. Davor gab er der britischen Wochenzeitung New Statesman ein Interview, das sofort Schlagzeilen machte. Mit freundlicher Genehmigung druckt die Weltwoche das Dokument nach — Varoufakis unplugged und in voller Länge.
Herr Varoufakis, wie geht es Ihnen?
Mir geht es fantastisch – ich muss nicht mehr von Termin zu Termin hetzen, das war unmenschlich, einfach unvorstellbar. Über fünf Monate habe ich täglich höchstens zwei Stunden schlafen können . . . Ich bin auch erleichtert, dass ich nicht mehr diesen unglaublichen Druck aushalten muss, in den Verhandlungen eine Position zu vertreten, die zu verteidigen mir schwerfällt, selbst wenn es mir gelungen ist, die andere Seite zum Einlenken zu bringen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Wie haben Sie diese Verhandlungen erlebt? Waren Sie gern dabei?
Ja, meistens schon. Aber die Insiderinformationen, die man bekommt . . ., da bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen . . . Man sitzt direkt den «Mächtigen» gegenüber, die mit einem sprechen, und es ist genau so, wie man es befürchtet hat . . . Es war noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Na ja, es war schon lustig, das alles hautnah mitzuerleben.
Was meinen Sie damit?
Ich meine die absolute Skrupellosigkeit dieser Leute, die angeblich die europäische Demokratie verteidigen. Die andere Seite hat keinen Zweifel daran gelassen, dass wir uns in der Analyse einig sind – was zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich niemand publik machen wird. [Und trotzdem] sitzen einem dann sehr mächtige Figuren gegenüber, die einem ins Gesicht sagen: «Es stimmt alles, was Sie sagen, aber wir werden Sie sowieso fertigmachen.»
Sie haben gesagt, die Gläubiger hätten Sie abgelehnt, weil «ich in der Euro-Gruppe über Ökonomie reden will, was dort niemand tut». Was passierte denn, wenn Sie über Ökonomie redeten?
Es war nicht einfach so, dass es nicht gut angekommen wäre. Sie haben es rundheraus abgelehnt, sich mit ökonomischen Argumenten auseinanderzusetzen. Ganz eindeutig . . . Man trägt ein Argument vor, an dem man wirklich gearbeitet hat, damit es logisch und kohärent ist – und erntet ausdruckslose Blicke. So, als hätte man gar nichts gesagt. Was die anderen äussern, hat überhaupt keinen Bezug zu dem, was man selbst gerade gesagt hat. Genauso gut hätte man die schwedische Nationalhymne singen können — man hätte dieselbe Reaktion ausgelöst. Und für jemanden, der akademische Debatten gewohnt ist, ist das schon verrückt . . . Die andere Seite ist immer dialogbereit. Nun ja, von Dialog keine Spur. Sie waren nicht mal verärgert; es war, als hätte man kein Wort gesagt.
Als Sie Anfang Februar auftauchten, kann das keine einheitliche Position gewesen sein.
Es gab Leute, die auf der persönlichen Ebene verständnisvoll waren, also hinter verschlossenen Türen, im informellen Gespräch, vor allem Vertreter des Internationalen Währungsfonds.
Auf höchster Ebene?
Auf höchster Ebene, ja. Aber in der Euro-Gruppe, ein paar freundliche Worte hinter dem Paravent der offiziellen Version; das war’s dann schon. Schäuble dagegen ist konsequent bei seiner Linie geblieben. Seine Position war: «Ich diskutiere nicht über das Programm – die Vorgängerregierung hat das akzeptiert, und wir können nicht zulassen, dass durch Wahlen etwas verändert wird. Wir haben ja ständig Wahlen, wir sind neunzehn, und wenn sich jedesmal etwas verändert, wenn irgendwo Wahlen stattfinden, wären Verträge zwischen uns sinnlos.» In der Situation bin ich aufgestanden und habe gesagt: «Also, vielleicht sollten in verschuldeten Ländern einfach keine Wahlen mehr abgehalten werden.» Keine Reaktion. Die einzige Interpretation, die mir dazu einfällt, ist die: «Ja, das wäre eine gute Idee, aber es ist nicht durchführbar. Also entweder Sie unterschreiben, oder Sie sind draussen.»
Und Merkel?
Sie müssen wissen, dass ich mit Merkel nie etwas zu tun hatte. Finanzminister sprechen mit Finanzministern, Regierungschefs sprechen mit Regierungschefs. Nach meinem Verständnis ist sie ein völlig anderer Typus. Sie hat versucht, den Ministerpräsidenten [Tsipras] zu beruhigen. Sie hat gesagt: «Keine Sorge, wir werden schon eine Lösung finden. Ich werde nicht zulassen, dass etwas Schlimmes passiert, machen Sie einfach Ihre Hausaufgaben und arbeiten Sie mit den Institutionen zusammen, mit der Troika, es wird keine ausweglose Situation geben.» Von meinen Kollegen habe ich so etwas nicht gehört, weder vom Chef der Euro-Gruppe noch von Dr. Schäuble, die waren ganz eindeutig. Einmal wurde mir unmissverständlich erklärt: «Dies ist ein Pferd, entweder Sie steigen auf, oder es ist tot.»
Wann war das?
Von Anfang an, von Anfang an [Varoufakis nahm ab Anfang Februar an den Verhandlungen teil].
Warum also bis zum Sommer warten?
Nun ja, wir hatten keine Alternative. Unsere Regierung wurde mit dem Auftrag gewählt, Verhandlungen zu führen. Unser erster Auftrag lautete also, den Raum und die Zeit zu schaffen, durch Verhandlungen ein anderes Abkommen zu erreichen. Das war unser Auftrag – wir sollten verhandeln und nicht unsere Gläubiger vor den Kopf stossen . . . Die Verhandlungen zogen sich ewig hin, weil die andere Seite nicht verhandeln wollte. Sie bestanden auf einem «umfassenden Abkommen», das heisst, sie wollten über alles reden. Ich interpretiere das so: Wenn man über alles reden will, will man über nichts reden. Aber wir haben das akzeptiert. Schauen Sie, die andere Seite hat überhaupt keine Vorschläge gemacht. Sie haben . . . ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Sie haben gesagt: «Wir brauchen alle eure Daten über den fiskalischen Weg, auf dem Griechenland sich befindet, wir brauchen sämtliche Daten über die Staatsunternehmen.» Also haben wir uns bemüht, diese Daten bereitzustellen und Fragebögen zu beantworten und diese Daten in zahllosen Sitzungen vorzulegen. Das war die erste Phase. Die zweite Phase war, dass sie uns fragten, wie es mit der Mehrwertsteuer weitergehen solle. Sie haben unseren Vorschlag dann zurückgewiesen, ohne ihrerseits einen Vorschlag zu unterbreiten. Und bevor wir überhaupt eine Chance hatten, zu einer Einigung in Sachen Mehrwertsteuer zu kommen, wandten sie sich einem anderen Thema zu, etwa der Privatisierung. Sie wollten wissen, wie wir die Privatisierung angehen wollten; wir machten Vorschläge, die sie dann zurückwiesen. Dann das nächste Thema, beispielsweise die Renten, dann ging es zu den Produktmärkten und von dort zum Arbeitsmarkt und zu allen möglichen anderen Themen. Wie eine Katze, die hinter ihrem eigenen Schwanz her ist. Wir fanden, also die Regierung fand, dass wir aus dem Prozess nicht aussteigen konnten. Schauen Sie, mein Vorschlag war von Anfang an der: Griechenland ist ein Land, das auf Grund gelaufen ist, schon vor langer Zeit . . . Zweifellos brauchen wir Reformen, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Und weil die Zeit drängte und die Europäische Zentralbank während der laufenden Verhandlungen Liquiditätshilfen für die griechischen Banken einschränkte, um uns unter Druck zu setzen, damit wir kapitulieren, war mein Vorschlag an die Troika ganz simpel: «Wir verständigen uns auf drei, vier wichtige Reformen, Steuergesetze, Mehrwertsteuer, und die werden unverzüglich umgesetzt. Und ihr lockert die eingeschränkten Liquiditätshilfen der EZB. Ihr wollt ein umfassendes Abkommen, dann lasst uns weiterverhandeln, und gleichzeitig bringen wir die Reformen, auf die wir uns verständigt haben, auf den parlamentarischen Weg.» Aber sie haben gesagt: «Nein, nein, nein. Es muss umfassende Reformen geben. Nichts wird umgesetzt, wenn Sie es wagen, irgendwelche Gesetze zu verabschieden. Das wäre aus unserer Sicht ein einseitiges Vorgehen, das die Chance, zu einer Einigung zu kommen, gefährden würde.» Und natürlich haben sie später dann den Medien erklärt, dass wir das Land nicht reformiert hätten und dass die ganze Sache Zeitverschwendung sei! Also, in gewisser Weise (Lacht) wurden wir einfach reingelegt. Als die griechischen Banken kaum noch liquide waren und das Land gegenüber dem IWF zahlungsunfähig war beziehungsweise kurz davor stand, kamen sie mit ihren Vorschlägen, die vollkommen unmöglich waren . . . Absolut unrealistisch und kontraproduktiv. Und so zogen sich die Dinge weiter hin, und schliesslich machten sie die Sorte Vorschlag, die man der anderen Seite unterbreitet, wenn man an einer Einigung gar nicht interessiert ist.
Haben Sie versucht, mit den Regierungen anderer verschuldeter Länder zusammenzuarbeiten?
Die Antwort ist: nein, und der Grund ist simpel: Von Anfang an haben diese bestimmten Länder keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die grössten Feinde unserer Regierung sind. Und der Grund war natürlich, dass unser Erfolg ihr schlimmster Albtraum war. Hätten wir bessere Bedingungen für Griechenland herausgeholt, wäre das ein politisches Problem für sie gewesen, denn dann hätten sie ihrer eigenen Bevölkerung erklären müssen, warum sie nicht genauso hart verhandelt hatten wie wir.
Und konnten Sie auf Sympathisanten zählen, wie etwa Podemos?
Nein. Ich meine, wir hatten immer gute Beziehungen zu Podemos, aber sie konnten nichts tun – ihre Stimme wurde in der Euro-Gruppe nicht gehört. Und in der Tat, je mehr sie für uns eintraten, desto feindseliger verhielt sich der spanische Finanzminister uns gegenüber.
Und George Osborne [der britische Finanzminister]? Wie sind Sie mit ihm zurechtgekommen?
Oh, es war sehr angenehm mit ihm, wir hatten ein ausgezeichnetes Verhältnis. Aber er gehört nicht zur Euro-Gruppe. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten mit ihm gesprochen und ihn als sehr aufgeschlossen erlebt. Und wenn man den Telegraph liest, sieht man, dass unsere grössten Anhänger die Torys sind! Weil sie Euro-Skeptiker sind, na ja, es ist nicht nur ihre Euro-Skepsis, sondern das [britische] Verständnis von Parlamentssouveränität – in unserem Fall war ganz klar, dass unser Parlament überhaupt nicht ernst genommen wurde.
Was ist aus Ihrer Sicht besonders problematisch an der Praxis der Euro-Gruppe?
Nur ein Beispiel: Es gab einen Moment, als der Euro-Gruppen-Chef beschloss, uns faktisch auszuschliessen und bekanntgab, dass Griechenland kurz vor dem Austritt aus der Euro-Zone stehe . . . Nun ist es üblich, dass Verlautbarungen von allen Beteiligten getragen werden müssen, der Euro-Gruppen-Chef kann also nicht einfach eine Sitzung einberufen und ein Mitgliedsland ausschliessen. Er sagte: «Ich bin sicher, dass das geht.» Daraufhin habe ich ein juristisches Gutachten angefordert. Es entstand grosse Aufregung. Die Sitzung wurde für fünf oder zehn Minuten unterbrochen, Beamte und Sekretäre telefonierten herum, und am Ende erklärte mir ein Experte: «Also, juristisch existiert die Euro-Gruppe nicht, es gibt keinen Vertrag, auf dessen Grundlage diese Gruppe geschaffen wurde.» Wir haben also eine nichtexistierende Gruppe, welche die allergrösste Macht über das Leben der Europäer hat. Sie ist niemandem rechenschaftspflichtig, da sie ja juristisch gesehen nicht existiert. Die Sitzungen werden nicht protokolliert, es ist alles vertraulich. Kein Bürger erfährt, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird . . . Bei diesen Entscheidungen geht es quasi um Leben und Tod, aber niemand ist irgendjemandem rechenschaftspflichtig.
Und wird diese Gruppe von deutschen Sichtweisen dominiert?
Oh ja, absolut, ganz und gar. Nicht von Sichtweisen, sondern vom deutschen Finanzminister. Das Ganze ist wie ein sauber gestimmtes Orchester, und er ist der Dirigent. Es gibt keine Misstöne. Manchmal ist das Orchester aber nicht sauber gestimmt, dann kommt er und sorgt dafür, dass alles wieder seine Ordnung hat.
Gibt es denn in der Euro-Gruppe keine Gegenspieler, können sich die Franzosen nicht gegen diese Macht stellen?
Nur der französische Finanzminister hat sich in einer Weise geäussert, die sich von der deutschen Position unterschied, aber das war alles sehr subtil. Man merkte, dass er in seiner Wortwahl sehr vorsichtig sein musste, um nicht als Kritiker der Deutschen wahrgenommen zu werden. Und wenn Doc Schäuble antwortete und die offizielle Linie praktisch festlegte, hat sein französischer Kollege letzten Endes immer eingelenkt und mitgemacht.
Sprechen wir über Ihren theoretischen Hintergrund und über Ihren Vortrag, den Sie 2013 [in Zagreb] gehalten haben, wo Sie sagten: «Ein Austritt Griechenlands oder Portugals oder Spaniens aus der Euro-Zone würde zu einer raschen Fragmentierung des europäischen Kapitalismus führen. Östlich des Rheins und nördlich der Alpen würde eine Überschussregion mit einer ernsthaften Rezession entstehen, während das übrige Europa im Griff einer massiven Stagflation wäre. Wer würde Ihrer Ansicht nach von dieser Entwicklung profitieren? Eine fortschrittliche Linke, die sich wie ein Phönix aus der Asche der öffentlichen Institutionen Europas erhebt? Oder die Nazis von der Goldenen Morgenröte, die diversen Neofaschisten, Ausländerfeinde und Kleinkriminellen? Für mich steht ausser Frage, wem ein Zerfall der Euro-Zone am meisten nützen würde.» Würde ein Grexit also zwangsläufig der Goldenen Morgenröte helfen, würden Sie das weiterhin sagen?
Schauen Sie, ich halte nichts von einer deterministischen Geschichtsauffassung. Syriza ist heute eine sehr starke Kraft. Wenn wir es schaffen, einig aus diesem Schlamassel herauszukommen und einen Grexit vernünftig anzugehen . . . eine Alternative wäre möglich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das schaffen, denn die Fragen, die sich beim Kollaps einer Währungsunion stellen, verlangen sehr viel Fachwissen, und ich bin mir nicht sicher, ob wir das in Griechenland ohne fremde Hilfe schaffen.
Sie müssen von Anfang an über einen Grexit nachgedacht haben.
Ja, das stimmt.
Wurden bereits Vorbereitungen getroffen?
Ja und nein. Wir hatten eine kleine Gruppe im Ministerium, eine Art Kriegskabinett, ungefähr fünf Leute, die sich damit beschäftigt haben. Wir haben theoretisch, auf dem Papier, sämtliche [für den Fall eines Austritts aus der Euro-Zone] notwendigen Schritte ausgearbeitet. Aber so etwas mit vier, fünf Leuten zu machen, ist das eine; das Land tatsächlich darauf vorzubereiten, ist etwas ganz anderes. Dafür hätte es eine Entscheidung auf der höchsten Ebene gebraucht, und diese Entscheidung hat es nie gegeben.
Und in der vergangenen Woche, war das eine Entscheidung, zu der Sie neigten [Vorbereitung für einen Grexit]?
Mein Standpunkt war, dass wir sehr vorsichtig sein sollten. Ich wollte nicht, dass das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird. Es sollte nicht so enden wie bei dem berühmten Ausspruch von Nietzsche, dass, wenn man nur lange genug in den Abgrund blicke, der Abgrund zurückschaue. In dem Moment aber, wo die Euro-Gruppe unsere Banken schliesst, sollten wir diesen Prozess in Gang setzen, das war meine Überzeugung.
Verstehe. Wenn ich das richtig sehe, gab es also zwei Optionen – einen sofortigen Grexit oder aber das Drucken von Schuldscheinen und die Übernahme der Kontrolle über die griechische Zentralbank [was potenziell, aber nicht zwangsläufig einen Grexit herbeigeführt hätte]?
Ganz genau. Ich war nie der Ansicht, dass wir sofort eine neue Währung einführen sollten. Meine Ansicht war, und ich habe das der Regierung gesagt, dass wir, wenn sie tatsächlich unsere Banken schliessen würden — ein für mich aggressiver Akt von enormer Tragweite — dass wir dann aggressiv reagieren sollten, aber nicht über den Punkt hinaus, wo es kein Zurück mehr gibt. Wir sollten unsere eigenen Schuldscheine ausgeben oder zumindest bekanntgeben, dass wir unsere eigene auf Euro lautende Liquidität ausgeben werden. Wir sollten die griechischen Staatsanleihen von 2012, welche die EZB hält, einem Schuldenschnitt unterwerfen oder einen solchen Schritt ankündigen. Und wir sollten die Kontrolle über die Bank von Griechenland übernehmen. Das waren aus meiner Sicht die drei Massnahmen, die wir ergreifen sollten, wenn die EZB unsere Banken schliessen würde . . . Ich habe das Kabinett warnend darauf hingewiesen, dass dies einen Monat lang passieren werde [die EZB schliesst unsere Banken], um uns ein demütigendes Abkommen aufzuzwingen. Als das passierte – und viele meiner Kollegen konnten nicht glauben, dass es passieren würde – wurde meine Empfehlung, «energisch» zu reagieren, sagen wir mal, überstimmt.
Und wie viel fehlte, dass es dazu gekommen wäre?
Also, wir waren in der Minderheit, zwei von sechs Leuten . . . Da es dann nicht so weit kam, erhielt ich die Anweisung, die Banken im Konsens mit der EZB und der Bank von Griechenland zu schliessen. Ich war dagegen, habe es aber getan, weil ich ein Teamplayer bin, ich glaube an kollektive Verantwortung. Und dann fand das Referendum statt, durch das wir enormen Auftrieb erhielten, genau die Bestätigung, welche die [von Varoufakis geplante] energische Antwort auf die EZB gerechtfertigt hätte, aber in derselben Nacht beschloss die Regierung, dass der Wille des Volkes, dieses entschiedene Nein, nicht zu dieser energischen Reaktion führen sollte. Es sollte vielmehr zu bedeutenden Konzessionen an die andere Seite führen, an den EU-Gipfel in Brüssel, wobei unser Ministerpräsident akzeptierte, dass wir – was immer passiert, was immer die andere Seite tut – keinesfalls in einer Weise reagieren, dass sie sich angegriffen fühlen. Und letzten Endes heisst das, dass man kapituliert . . . Man verhandelt nicht mehr.
Sie haben vermutlich keine Hoffnung, dass diese Vereinbarung besser ist als die von letzter Woche – wenn überhaupt, dann wird sie schlechter sein?
Wenn überhaupt, dann wird sie schlechter sein. Ich hoffe wirklich, dass unsere Regierung auf einer Umschuldung besteht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Finanzminister dies in der nächsten Sitzung der Euro-Gruppe akzeptieren wird. Wenn doch, wäre das ein Wunder.
Genau, weil Sie, wie Sie erklärt haben, keinerlei Druckmittel mehr haben.
Ja, so sehe ich das. Es sei denn, er [Schäuble] erhält von der Kanzlerin seinen Marschbefehl. Es bleibt abzuwarten, ob sie das tun wird.
Könnten Sie in möglichst einfachen Worten erklären, was Sie an Thomas Pikettys Buch «Das Kapital im 21. Jahrhundert» kritisieren?
Ich möchte vorweg sagen, dass mir das unangenehm ist, weil Piketty mich und die Regierung sehr unterstützt hat, obwohl ich in meiner Rezension seines Buches so hart mit ihm umgesprungen bin! Ich weiss seine Haltung, die er in den letzten Monaten vertreten hat, sehr zu schätzen, und ich werde ihm das auch persönlich sagen, wenn wir uns im September treffen. Von meiner Kritik an seinem Buch nehme ich jedoch nichts zurück. Sein Ansatz ist richtig, seine Empörung über Ungleichheit . . . Aus meiner Sicht schwächt seine Analyse aber die Argumentation. Denn das neoklassische Kapitalismusmodell lässt wenig Raum für die These, die er in seinem Buch aufstellt. Sein Modell gründet auf ganz speziellen Parametern, so dass seine Argumentation auf schwachen Füssen steht. Mit anderen Worten, wenn ich ein Kritiker seiner These wäre, dass die Ungleichheit der Einkommensverhältnisse ein Wesenszug des Kapitalismus ist, könnte ich seine Argumentation auseinandernehmen, indem ich einfach seine Analyse angreife.
Ich möchte nicht allzu sehr in die Einzelheiten gehen, denn hier soll kein endgültiges Urteil gefällt werden . . .
Ja.
. . . aber es geht um seinen Vermögensbegriff?
Ja, er verwendet eine Definition von Kapital, mit der man das Kapital unmöglich verstehen kann – das ist also ein Widerspruch in sich.*
Kommen wir wieder auf die Krise zurück. Ich würde gern wissen, welche Beziehung Sie zu Tsipras haben.
Wir kennen uns seit Ende 2010, ich war ein prominenter Kritiker der damaligen Regierung, auch wenn ich ihr nahestand, aber das ist lange her. Ich war mit den Papandreous befreundet, bin ich heute noch in gewissem Sinne, aber ich wurde prominent . . . Damals war es eine grosse Sache, dass ein ehemaliger Berater sagte: «Wir tun so, als habe es eine Zahlungsunfähigkeit nie gegeben, wir kaschieren das mit immer neuen unhaltbaren Krediten», solche Sachen. Das hat damals für einiges Aufsehen gesorgt, und Tsipras war ein blutjunger Politiker, der verstehen wollte, was Sache war, worum es bei der Krise ging und wie er sich positionieren sollte.
Erinnern Sie sich an die erste Begegnung?
Oh ja. Das war Ende 2010, wir waren zu dritt, wir sassen in einer Cafeteria, ich weiss noch, dass er in seinen Ansichten nicht ganz klar war, zur Frage «Drachme versus Euro», zu den Ursachen der Krise, und ich hatte, sagen wir mal, sehr feste Ansichten über das, was da geschah. Und dann begann ein Dialog, der sich über die Jahre weiterentwickelt hat . . . Ich glaube, dass ich ein wenig dazu beigetragen habe, dass seine Auffassungen über das, was getan werden muss, klarer geworden sind.
Und jetzt, nach viereinhalb Jahren, wie ist das für Sie, nicht mehr an seiner Seite zu arbeiten?
So sehe ich das überhaupt nicht. Wir sind uns sehr nahe. Unser Abschied war sehr herzlich. Wir hatten nie Probleme miteinander, nie, bis heute nicht. Und ich verstehe mich sehr gut mit Euklid Tsakalotos [neuer griechischer Finanzminister].
Und vermutlich sprechen Sie mit den beiden diese Woche?
Mit dem Ministerpräsidenten habe ich in dieser Woche noch nicht gesprochen, in den letzten Tagen, aber ich spreche mit Euclid, ja, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und umgekehrt, und ich beneide ihn überhaupt nicht. (Lacht)
Wären Sie schockiert, wenn Tsipras zurückträte?
Mich kann inzwischen nichts mehr schockieren – die Euro-Zone ist ein sehr ungemütlicher Ort für anständige Leute. Es würde mich auch nicht schockieren, wenn er weitermachte und einen wirklich schlechten Deal akzeptierte. Weil ich weiss, dass er sich den Menschen, die ihn unterstützen, die uns unterstützen, verpflichtet fühlt und alles dafür tun muss, dass Griechenland am Ende nicht als gescheiterter Staat dasteht. Aber ich werde weiterhin die Auffassung vertreten, die ich schon 2010 vertreten habe, dass Griechenland mit diesem «Immer so weiter» aufhören muss, damit, immer neue Kredite aufzunehmen und so zu tun, als wäre das Problem damit gelöst. Unter den Bedingungen verschärfter Austerität, die zu einem weiteren Schrumpfen der Wirtschaft führt, ist die Staatsverschuldung noch unhaltbarer geworden, die Last wird in noch grösserem Umfang auf die Armen abgewälzt, und auf diese Weise landen wir am Ende in einer humanitären Krise. Das akzeptiere ich nicht, und das werde ich nicht mittragen.
Abschliessende Frage: Werden Sie dem einen oder anderen Politiker, mit dem Sie verhandeln mussten, freundschaftlich verbunden bleiben?
Oh, da bin ich mir nicht sicher. Ich werde jedenfalls keine Namen nennen, um ihnen nicht die Karriere zu vermasseln! (Lacht)
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2015-30/wir-wurden-reingelegt-die-weltwoche-ausgabe-302015.html
Mehr auf:
- Idiot´s Guide to the Global Economy / Wie funktioniert die globalisierte Wirtschaft?
- Von Euro-Idylle zur “Griechenland-Krise”
28.07.2015 Achgut.com
Gedanken zur möglicherweise künftig ehemaligen Hellenischen Republik
Von Matthias Heitmann
Was als europäische Gesamtanstrengung zur Rettung Griechenlands firmiert, ist in Wahrheit der größte politische Souveränitätstransfer, den die Welt in Friedenszeiten je gesehen hat.
Als ich kürzlich mit Freunden aus Großbritannien über die anstehenden Ferienpläne sprach und ihnen erzählte, dass dieses Jahr Griechenland mein Urlaubsziel sei, kommentierten sie dies leicht ironisch mit der gespielt ungläubigen Frage „So basically, you are staying in your country?“ („Du bleibst also im eigenen Land?“). Der britische Humor vermag es auf großartige Weise, Aussagen bis fast zur Unkenntnis zu verklausulieren und sie dabei gleichzeitig in ihrer Schärfe noch zu betonen. Beim Thema Griechenland drängt es sich geradezu auf, sich dieser Ausdrucksform zu bedienen. Ohnehin ist es hilfreich, hierzu auch einmal eine andere Sichtweise als die erschreckend einstimmige deutsche anzuhören.
Von welchem internationalen Standpunkt man es auch betrachtet, das politische Agieren der griechischen Syriza-Regierung erntet ein nahezu globales Kopfschütteln – selbst bei vielen bisherigen Anhängern und Sympathisanten. Seit ihrem Amtsantritt zu Beginn dieses Jahres hat die griechische Regierung nichts unternommen, um den drohenden Kollaps der griechischen Unabhängigkeit zu verhindern. Seit gefühlten Ewigkeiten schielen die europäischen Schuldner auf das Tafelsilber des griechischen Staats, kooperieren mit den immer abhängiger werdenden griechischen Banken und versenken diese schleichend immer tiefer in ihrem eigenhändig angelegten Schuldensumpf.
Eine sich selbst ernstnehmende Regierung eines in seiner Souveränität existenziell bedrohten Landes würde – unabhängig von der eigenen politischen Ausrichtung – zumindest darüber diskutieren, ob es nicht von entscheidender Bedeutung für die eigene Zukunft wäre, wichtige Wirtschaftszweige oder Banken stärker unter die eigene staatliche Kontrolle zu nehmen und sie so zumindest vorläufig vor dem internationalen Zugriff zu schützen. Auch die nun in verschiedenen Medien kolportierten „Putschgerüchte“ sowie Geheimpläne, der inzwischen ehemalige griechische Finanzminister Giannis Varoufakis sei bereits Ende letzten Jahres vom heutigen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras beauftragt worden, mithilfe eines Hackers ein „Parallel-Bankensystem“ entwickelt zu haben, wirken fast wie eine posthume Dämonisierung einer längst zahnlosen Regierung. Über die europäische Aufregung angesichts der so geheimen „Geheimpläne“ von Varoufakis kann man eigentlich nur lachen. Wer, wenn nicht die Griechen, hätte denn sonst Überlegungen über einen Grexit anstellen sollen?
Griechische Selbstveräußerung
In einer Mischung aus grandioser Selbstüberschätzung, stolzer Blindheit, atemberaubender Naivität und bewusster Falschheit verbrachte die Syriza-Regierung Monate damit, unvorbereitet und ohne eigene Alternativvorschläge bei Brüsseler Treffen aufzukreuzen und außer dem offiziellen Wunsch, auch das kommende Weihnachtsfest in der Eurozone feiern zu dürfen, nichts beizusteuern. Dass sie dies der griechischen Bevölkerung obendrein als stolze Rettungsstrategie zu verkaufen versuchte, ist geradezu kriminell, offenbart auch aber auch eine unglaubliche Portion an Feigheit: Anstatt offensiv den Austritt aus dem Euro zu betreiben und in der griechischen Bevölkerung für die eigenen Pläne um Unterstützung zu werben, zog man es vor, lieber gar keine ernstzunehmende Position in den Brüsseler Verhandlungen einzunehmen und zu Hause vorzugaukeln, man könne gleichzeitig Sparprogramme ablehnen und den Euro behalten.
Nichts hat die Regierung in Athen in den letzten Monaten unternommen, um die Menschen in Griechenland vor dieser nun anlaufenden historisch einzigartigen Demütigung durch die EU-Bürokraten zu bewahren. Stattdessen trommelte Tsipras das Volk sogar noch einmal an die Urnen und spielte ihm vor, mit dessen Votum im Rücken sich mutig den Spardiktaten entgegenzustellen. Ausgestattet mit einer satten Mehrheit gegen die Vereinbarung weiterer Sparmaßnahmen ließ sich Tsipras in den Tagen nach dem Referendum genau auf solche und auf noch viel Schlimmeres ein: Griechenland hat große Teile seines staatlichen Tafelsilbers in einen von den internationalen Geldgebern kontrollierten Privatisierungsfond abzutreten, dessen Ziel es ist, für diese noch übrig gebliebenen Sahnestückchen griechischen Wirtschaftens internationale Käufer zu finden. Dies, wohlgemerkt, nur als Voraussetzung dafür, künftig überhaupt wieder um weitere Hilfen bett- äh verhandeln zu dürfen.
Was hier als europäische Gesamtanstrengung zur Rettung Griechenlands firmiert, ist in Wahrheit der größte politische Souveränitätstransfer, den die Welt in Friedenszeiten jemals gesehen hat. Und es ist davon auszugehen, dass nach der Veräußerung des bisher zum Verkauf gestellten Staatsvermögens weitere Privatisierungswellen folgen werden. Wie diese aussehen können, lässt sich derzeit am Beispiel des Privatisierungsdeals mit der Frankfurter Fraport AG besichtigen, der im letzten Jahr von der damals regierenden konservativen griechischen Regierung eingefädelt worden war: Neben etlichen anderen Staatsbetrieben sollte Griechenland seine 14 gewinnbringenden und weiter wachsenden Flughäfen an Fraport verkaufen, während die anderen 30 Flughäfen, die keine Gewinne verbuchen und auf Subventionen angewiesen sind, griechisches Staatseigentum bleiben sollen.
Mit den von der damaligen Regierung in Athen erhofften Einnahmen aus diesem Deal von ca. 1,23 Milliarden Euro – für die Konzession für den Betrieb von 14 griechischen Flughäfen für 40 Jahre ein geradezu teuflisches Schnäppchen – sollten weitere Schulden beglichen werden. Man muss kein fanatischer Antikapitalist, Euroskeptiker oder Syriza-Sympathisant sein, um der vom griechischen Infrastrukturminister Christos Spirtzis geäußerten Einschätzung zuzustimmen, dass dies „eher zu einer Kolonie als zu einem EU-Mitgliedsland“ passe.
Der Euro ist ein rein politisches Projekt
Was mittlerweile selbst von Experten des Instituts für Wirtschaftsforschung als Gefahr einer möglicherweise „übereilte Privatisierung“ beschrieben wird, ist in Wirklichkeit zentraler Bestandteil der Griechenlandpolitik der Europäischen Union. Diese hat nicht die Rettung Hellas, sondern die des Euro zum Ziel – und zwar nicht seine wirtschaftliche Rettung, sondern die politische. Je stärker das auf Basis des Euro als Einheitswährung errichtete politische System der EU ins Wanken gerät, desto skrupelloser wird der Umgang mit Athen oder auch mit anderen sich künftig anbietenden Problemregierungen werden. In Brüssel zählen nicht die Griechen – vielmehr hat der offene Kampf um die Aufrechterhaltung des Euro-Systems begonnen. In diesem System ging und geht es nicht um die Wirtschaft, das europäische Projekt war von jeher ein politisch motiviertes. Daher wird an ihm auch so verzweifelt und ängstlich-borniert festgehalten, selbst angesichts eines wirtschaftlichen Desasters.
Seit den Maastrichter Verträgen von 1992 wurde der Mythos der Unumkehrbarkeit der europäischen Einigung mit Zähnen und Klauen verteidigt. Dies war gerade Anfang der 1990er-Jahre für die Staaten Europas von zentraler Bedeutung, ging es doch vor allen Dingen auch darum, das frisch wiedervereinigte Deutschland in das gemeinsame System fest einzubauen. Deutschen Interessen lief das nicht unbedingt zuwider, der Euro schien nicht nur ein zahlbarer Preis für die Wiedervereinigung zu sein, sondern bot sich zugleich als attraktive politische Perspektive für das neu entstandene mächtigste Land Europas an. Darüber hinaus konnte man so das große Misstrauen der europäischen Nachbarn wie auch der liberalen und linken Teile der innerdeutschen Öffentlichkeit besänftigen. Die Auflösung in ein vereinigtes Europa erschien gerade für Liberale und Linke die einzige Möglichkeit zu sein, die „deutsche Frage“ in einer eher unproblematischen Art und Weise zu lösen. Der Euro war also in gewisser Weise das Symbol für die politische wie auch wirtschaftliche Einbindung des misstrauisch beäugten zentraleuropäischen Riesens in den europäischen Einigungsprozess mit dem Ziel, dessen erneutes unerfreuliches Ausscheren möglichst zu verhindern.
Unumkehrbarkeit als einzige EU-Zukunftsvision
Die Vereinigung Europas in Form der Europäischen Union wurde gerade deswegen zur einzig denkbaren Zukunftsvision und musste verteidigt werden. Da konnten Menschen in Europa in zahlreichen Referenden sich noch so deutlich gegen europapolitische Grundsätze aussprechen – deren Votum wurde selbstbewusst ausgeblendet, um diesen Weg der unumkehrbaren Integration nicht zu gefährden. Die ständig offener zutage tretende Abgehobenheit Europas von seinen Bürgern ist somit kein unerwünschter Nebeneffekt, den man „wegreformieren“ kann – sie ist das Fundament des EU-Projektes, das nur als dem direkten demokratischen Zugriff der Bürger entzogenes und über den Menschen und Staaten stehendes, gewissermaßen „entpolitisiertes“ Gebilde überleben kann.
Den hohen Grad der „Entpolitisierung“ des europäischen Prozesses kann man in der Griechenland-Tragödie nahezu mit Händen greifen. Nach der vorauseilenden und präventiven Kapitulation von Tsipras in den Tagen nach dem griechischen Referendum wird das Land nun langsam Stück für Stück durch den europäischen Fleischwolf gedreht, um europäisch bleiben zu dürfen. Und es scheint niemanden zu geben, der sich diesem blutrünstigen Automatismus, von dem niemand ein positives Endresultat erwartet, ernsthaft entgegenstellt. Niemand? Vielleicht nicht ganz. Denn aus einer überraschenden Richtung wird nicht nur Skepsis geäußert, sondern hörbar über ein Umsteuern nachgedacht. Bei aller bisher zur Schau getragenen Härte ist es durchaus vorstellbar, dass ausgerechnet Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dereinst als der erste aus dem EU-Machtkartell in die Geschichte eingehen wird, der offen die Irreversibilität der Euro-Politik infrage und einen zumindest begrenzten Austritt Griechenlands aus dem Euro als womöglich bessere Lösung in den Raum stellte.
Dass Schäubles zentrales Motiv der Lockerung des starren Eurosystems nicht unbedingt das Mitleid mit den Griechen ist, erscheint plausibel. Und dennoch könnte diese Äußerung der Beginn eines sich langsam entwickelnden Ausweg Griechenlands aus der aussichtslosen Lage sein. Die wütenden Reaktionen in Brüssel wie auch in Berlin auf den Vorstoß Schäubles deuten jedenfalls darauf hin, dass er den Finger in die zentrale Wunde gelegt hat: Die Möglichkeit der Unumkehrbarkeit europäischer Einigungspolitik überhaupt in Betracht zu ziehen, bedeutet auch, ihre Unfehlbarkeit für prinzipiell möglich zu halten. Dieser geradezu infame Gedanke lässt das Brüsseler Machtzentrum bereits ins Wanken geraten – noch dazu, da er vom mächtigsten Finanzminister der Eurozone geäußert wurde.
Chancen wachsen in der Krise
Den Kritikern des EU-Spardiktats und der faktischen Entmündigung des griechischen Staates stünde es gut zu Gesicht, sich im Ringen um weniger Brüsseler Bürokratie nicht in traditioneller Manier auf blinde und arg vereinfachende anti-deutsche Ressentiments zu beschränken. Denn es ist ja gerade das Misstrauen Europas gegenüber Deutschland, aus dem sich der EU-Apparat erhob und bis heute speist. Mit dem Ausspielen der anti-deutschen Karte kittet man unbewusst die Risse im Brüsseler Beton und verhindert so, dass hieraus eventuell ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten entstehen. Und auch, wenn sich der Enthusiasmus der spanischen Syriza-Anhänger („Podemos“) nach der griechischen Selbstveräußerung durch Tsipras nun erst einmal ein wenig gelegt haben dürfte – aktuelle Umfragen scheinen dies auf beeindruckende Weise zu belegen: Die griechische Tragödie könnte bei all ihren katastrophalen sozialen Begleiterscheinungen dennoch möglicherweise den Bremsvorgang für den auf Autopilot geschalteten Euro-Geisterzug einleiten. Vorausgesetzt, man verschließt nicht aus lauter Angst die Augen vor der Tatsache, dass die Europäische Union kein Naturgesetz, sondern menschgemacht und daher auch reversibel ist.
Matthias Heitmann ist freier Autor. Soeben ist im TvR Medienverlag Jena sein Buch „Zeitgeisterjagd. Safari durch das Dickicht des modernen politischen Denkens“ erschienen. Mehr Informationen finden sich auf seiner Website http://www.zeitgeisterjagd.de. Dieser Artikel ist zuerst in der BFT Bürgerzeitung erschienen.
Euro
Friedman hatte recht
Der Euro war eine große wirtschaftspolitische Fehlentscheidung – jetzt gilt es, zu retten, was noch zu retten ist. Wir brauchen eine Währungsunion, in der Staaten pleitegehen können. von Mark Schieritz

Eine Frau vor einem Geschäft in Lissabon | © Rafael Marchante/Reuters
Als in den neunziger Jahren in Europa die Einführung des Euro vorbereitet wurde, verfasste der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman einen kurzen Aufsatz über die neue Währung. Sie werde den Kontinent nicht, wie erhofft, vereinen, sondern spalten – denn durch das gemeinsame Geld würden wirtschaftliche Anpassungsprozesse, „die durch Änderung der Wechselkurse leicht in Griff zu bekommen worden wären“, mit einem Mal zu „umstrittenen politischen Themen“.
Es gab damals viele Mahner wie Friedman. Sie wurden allesamt ignoriert. Der Euro war längst zum Symbol für den europäischen Einigungsprozess geworden – und er versprach einen Ausweg aus den Zwängen der Globalisierung. Man glaubte, dass durch das gemeinsame Geld auf der europäischen Ebene wirtschaftspolitische Handlungsspielräume zurückerobert werden können, die der Nationalstaat längst verloren hat.
Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Friedman hatte recht. Der Euro ist vielleicht eine der größten wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen des vergangenen Jahrhunderts – und wenn nicht schnell etwas passiert, wird er Europa zerstören.
Gewiss: Der Grexit ist vorerst abgewendet, und der Bruch der Währungsunion konnte gerade noch einmal abgewendet werden. Doch um welchen Preis? Die Einigung kostet viel Geld, doch dass sie Griechenland Wachstum und Wohlstand bringt, ist eher unwahrscheinlich. Griechenland ist dabei nur das krasseste Beispiel für das Scheitern der europäischen Rettungsbemühungen. In den anderen Krisenstaaten mag die Wirtschaft nicht mehr akut von dem Zusammenbruch bedroht sein, aber das bedeutet noch lange nicht, dass dort alles in Ordnung wäre. Die Arbeitslosigkeit liegt zum Beispiel in Spanien immer noch bei über 20 Prozent. Wenn das schon als Erfolg gilt, was wäre dann eigentlich ein Misserfolg?
Der Euro hat sich eben nicht als Wohlstandsmaschine, sondern als Wohlstandsvernichtungsmaschine erwiesen. In mehr als der Hälfte aller Mitgliedsländer der Währungsunion liegt die Wirtschaftsleistung heute unter dem Niveau des Jahres 2007. Die europäischen Staaten mit einer eigenen Währung dagegen stehen heute alle besser da als damals. Die traurige Wahrheit dieser Tage ist, dass das ebenfalls hoch verschuldete und ebenfalls nicht gerade vorbildlich regierte Ungarn gut durch die Krise gekommen ist, während Griechenland in der Depression versank.
Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 31 vom 30.07.2015. http://www.zeit.de
Die Krise des Euro – sie ist eben genau das: eine Krise des Euro. Die gemeinsame Währung sollte dem Kontinent ökonomische Stabilität bringen, sie brachte das Gegenteil. In den ersten zehn Jahren nach seiner Einführung bescherte der Euro dem Süden einen ungesunden Boom und dem Norden eine lang anhaltende Flaute. Jetzt drehen sich die Verhältnisse gerade um, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die deutsche Wirtschaft heiß läuft. Seit die Menschen von Helsinki bis Lissabon mit dem Euro bezahlen, schwanken in Europa zwar keine Währungen mehr, dafür schwanken jetzt ganze Länder.
Das liegt auch daran, dass die Währungsunion für die meisten ihrer Mitgliedsstaaten eine ökonomische Zwangsjacke ist. Sie schränkt – die Griechen erfahren es gerade – die nationalen wirtschaftspolitischen Reaktionsmöglichkeiten ein, weil die eigene Währung nicht mehr abgewertet werden kann, um die Wirtschaft wieder auszubalancieren. Auf der supranationalen Ebene wiederum fehlen die Instrumente, um dieses Defizit auszugleichen. Es gibt eben kein gemeinsames Budget, aus dem sich Krisenstaaten bedienen könnten, um einen Konjunkturabschwung durch Mehrausgaben abzufedern. Die europäischen Haushaltsregeln mit ihren Schuldengrenzen legen der Finanzpolitik in den Mitgliedsländern stattdessen sogar noch zusätzliche Fesseln an. Die Währungsunion, so formuliert es der dänische Wirtschaftswissenschaftler Lars Christensen, sei ein „monetärer Strangulationsmechanismus“.
Auf jeden Rausch folgt der Kater – das ist auch in Ländern mit einer eigenen Währung so. Aber innerhalb einer Währungsunion müssen die nach dem Platzen einer Blase notwendigen Anpassungsleistungen mühsam durch Lohnkürzungen erbracht werden. Die damit einhergehende Politisierung der Wirtschaft überfordert die europäische Politik.
Sicher: Auf den ersten Blick hat die europäische Methode der Konfliktbewältigung funktioniert: Es gab einen Kompromiss, und niemand hat sein Gesicht verloren. Aber was ist ein Kompromiss wert, der keine Probleme löst, sondern neue Probleme schafft, weil keine Seite bereit ist, ihre roten Linien zu überschreiten? Der Euro ist eine Währung, kein sakraler Endzweck. Er mag aus politischen Gründen eingeführt worden sein, gemessen werden wird er am Ende an ökonomischen Kriterien. Wenn er die Menschen in Europa nicht reicher, sondern ärmer macht, verliert er seine Legitimation.
http://www.zeit.de/2015/31/waehrungsunion-euro-europa-krise
Nun steigt der IWF voraussichtlich aus dem neuesten Hilfspaket für Griechenland aus. Das ist eine Bankrotterklärung; diesmal nicht für das bankrotte Griechenland, sondern gleich auch noch für die Bundesregierung. Und dabei geht es nicht um die Milliarden, die der IWF nicht einsetzt, und die jetzt den Anteil Deutschlands erhöhen.
Der IWF stellt das Grundprinzip der Hilfen seit 2010 in Frage.
Und er zwingt die Bundesregierung zur Ehrlichkeit: Sie muß jetzt die deutschen Verpflichtungen offenlegen.
1. Das ist der Konflikt
Der IWF fordert eine weitgehende Entschuldung Griechenlands und echte Reformen. Das verbirgt sich hinter der Erklärung: “Der IWF kann nur ein umfassendes Programm unterstützen“, die ein Vertreter der Organisation in einer Telefonkonferenz mit Journalisten abgab.
Weiter heißt es da: Es müssten auf beiden Seiten schwierige Entscheidungen getroffen werden. Nötig sei eine Kombination von Reformen von griechische Seite und einem Schuldennachlass der Gläubiger. Bis sich beide Seiten darauf einigten, werde noch einige Zeit vergehen. Der IWF könne sich erst beteiligen, wenn entsprechende Beschlüsse gefallen seien. Diese Erklärung liegt auf der Linie, die der IWF seit einigen Wochen verfolgt – auch auf Grund des Drucks vieler nicht-europäischer Länder. Sie sehen einfach nicht ein, warum eine korrupte Winzwirtschaft wie die griechische mit immer neuen Mitteln aufgepäppelt wird, wobei diese Mittel praktisch unmittelbar in Beamtengehälter und Renten fließen. Die sind aber im Weltmaßstab maßlos überhöht. Mit anderen Worten: Warum sollte ein armes asiatisches Land sich reformieren, während Griechenland aus deren Perspektive Mittel verprasst?
Die Forderung von IWF-Chefin Christine Lagarde nach einer Schuldenerleichterung lehnen die Bundesregierung und andere EU-Ländern bislang ab. “Die Unterschiede zwischen der Meinung des IWF zur Schuldenfrage und der derzeitigen Diskussion der Europäer sind sehr groß”, zitiert die “Financial Times” aus einem vertraulichen IWF-Papier.
2. Was bedeutet ein erneuter Schuldenschnitt?
Nicht nur die Bundesregierung, vor allem die Linke und die Grünen suggerieren, bislang wäre kein deutsches Geld nach Griechenland geflossen. Das ist so schon deshalb falsch, weil beim ersten Schuldenschnitt 2010 immerhin 120 Milliarden Schulden erlassen wurden. Dieser „Haircut“ trifft nicht irgendwelche anonymen und bösen Banken, denen man endlich das Geld weg nimmt, wie die linksblinde deutsche Politik so gern suggeriert. Es sind im wesentlichen Mittel von Lebensversicherungen, Sparkassen und ganz normale Einlagen, die da verloren gegangen sind. Die Bundesregierung hat ihre Beteiligung an der misslungenen Griechenlandhilfe versteckt; und zwar in Form von „Garantien“. Garantien heißt: Es fließt heute kein Geld, aber wenn Griechenland seine Kredite nicht zurückzahlen kann, wird es fällig. Die Hoffnung war, diesen Tag hinauszuschieben, Zeit zu schinden, wie es eben in der Logik der auf Wahltermine orientierten Politik so üblich ist. Jetzt zwingt der IWF zur Aufdeckung dieser Garantien, indem der IWF einen Schuldenschnitt fordert. Das bedeutet: Je nach Rechnung zwischen 90 bis 130 Milliarden werden teilweise abgeschrieben; die Staatsverschuldung dementsprechend erhöht. Denn Deutschland haftet über verschiedenste Kanäle: Die Europäische Zentralbank beispielsweise hat Griechenland über 90 Mrd. für erkennbar faule Papiere geliehen – auch da ist Deutschland mit seinem 27-Prozent-Anteil dabei. Verschiedene Europäische Kostenverschleierungssysteme wie der Europäische Stabilitätsfonds wurden errichtet; auch da trägt Deutschland den Hauptanteil. Insofern sind wir dem IWF zum Dank verpflichtet: Er deckt die verdeckten Karten der Politik auf. Die „kostet-ja-nichts-sondern-bringt-uns-Zinsen-Schwindelei“ fliegt auf: Die Garantien sind bares Steuergeld, das dann in Deutschland vorne und hinten fehlt. Übrigens: Seine eigenen Milliarden will der IWF natürlich zurück. Nur die europäischen Staaten sollen bluten für Griechenland.
3. Was sind die Auswirkungen auf Europa?
Deutschland mit seiner vergleichsweise niedrigen Schuldenlast und praktisch keinerlei Neuverschuldung kann das Thema wegstecken; es schmerzt. Aber Frankreich und Italien geraten voll in die Bredouille. Ihre Kreditwürdigkeit sinkt weiter, wenn ihre Garantien offengelegt werden. Jetzt zeigt sich, dass das europäische Haus auf schwankendem Grund errichtet wurde: Der Hoffnung, dass schon keiner so genau hinschaut. Die Folgen sind schwer abzuschätzen. Jetzt geht es nicht mehr um die Rettung Griechenlands – jetzt geht es um die wankenden Giganten Frankreich, Italien, Spanien usw.usf. Vermutlich wird jetzt wieder eine „europäische Lösung“ gesucht mit dem Ziel, die Hauptlast der Schulden auf Deutschland abzuwälzen. Das Mittel der Wahl sind dann immer „Euro-Bonds“. Dann bürgt Deutschland für europäische Schulden. Die SPD hat dies lange gefordert; Grüne/Linke sowieso. Mit anderen Worten: Das halbwegs solide Deutschland soll für die Schulden der anderen garantieren. Dann erleben wir das Griechenland-Desaster erneut – nur in einer viel größeren Dimension.
4. Kommt Griechenland davon?
Der IWF kritisiert aber auch die griechische Regierung. Sie habe eben Reformen bislang unterlaufen. Die neue Regierung unter Alexis Tsipras hat diesen Boykott der Erneuerung zum Prinzip erhoben und sich sogar per Volksabstimmung bestätigen lassen. So lange Griechenland so auf Kosten der Kreditgeber weiterwurstelt, ist der IWF nicht mehr dabei. Auch das ist eine Bankrott-Erklärung für Politik und übrigens auch für viele Medien, die ständig die Reformen und großen Opfer der Griechen anführen und beklagen. Griechenland ist ein Sumpf, sagt der IWF. Nach nur 6 Monaten Syriza-Regierung steht Griechenland wirtschaftlich so schlecht da wie noch nie – und das Geld auch des neuen Hilfspakets wird wieder nicht reichen, kann jetzt gar nicht mehr reichen. Denn griechische Unternehmen gingen wegen der Bankschließung pleite, Unternehmen wanderten ab, der Tourismus brach ein. Die Folgen der sozialistischen Politik sind nach Schätzungen griechischer Statistiker ein Einbruch von voraussichtlich weiteren 10 Prozent in nur 6 Monaten. Innenpolitisch ist Griechenland instabil, denn die extreme Linke spielt nicht mehr mit. Auch Tsipras schließt Neuwahlen nicht aus.
5. Fazit: Scheitern auf der ganzen Linie
Damit ist die Griechenland-Hilfe-Politik auf der ganzen Linie gescheitert. Das Verdecken heimlicher Hilfen vor den Wählern fliegt auf. Der Euro wird zur gigantischen Umverteilungsmaschine. Denn jetzt wird wieder Panik als Argument angeführt werden, um alle möglichen Hilfen loszueisen. Jetzt wird wieder mal die Kriegs-Drohung herausgeholt; und klar ist: Der Unsinn geht weiter. Dagegen gibt es nur eine Möglichkeit: Einen sofortigen Grexit, um das kranke Griechenland von Europa zu isolieren – und vermutlich muß der Euro jetzt wirklich auf den Prüfstand. Es ist wie in Christian Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern: Der IWF ruft: “Griechenland ist nackt!”. Und jetzt sehen es alle.
Europa und der Nationalsozialismus
https://www.zeithistorische-forschungen.de/3-2012/id%3D4673
1. Antiliberal, antieuropäisch?
2. Handels- und Währungspolitik im „Neuen Europa“
3. Massenmord und Währungsstabilisierung
4. Weiterführende Überlegungen

Beschirmt, besetzt, in Fängen? Nationalsozialistische Europaideologie auf einem Plakat von 1943
(Bundesarchiv, Plak 003-002-044, Grafiker: Werner von Axster-Heudtlaß)
![]() 1. Antiliberal, antieuropäisch?
1. Antiliberal, antieuropäisch?
In der gegenwärtigen Krise europäischer Integration richtet sich der kritische Blick der Historiker auch auf problematische Ursprünge „Europas“ im 20. Jahrhundert, und hier besonders auf die NS-Zeit. Die zeitweilige deutsche Hegemonie über den Kontinent während des Zweiten Weltkriegs, die mit millionenfachen Massenmorden verbunden war, wurde in Teilen der Literatur als Ausdruck antieuropäischer Ideologie und Praxis bezeichnet,1 die Anwendung des Integrationsbegriffs auf die nationalsozialistische Herrschaftsausübung dagegen scharf kritisiert, ja sogar als „Pseudowissenschaft“ abgetan.2 Im Kontext des vorliegenden Themenhefts und im Licht neuerer Forschungen soll hier noch einmal gefragt werden, ob und wie sich die Zeit des Nationalsozialismus und besonders des Zweiten Weltkriegs als Teil europäischer Integrationsgeschichte interpretieren lässt.
Gleich vorab ist zu betonen, dass Liberalismus und Antiliberalismus dabei nicht antithetisch gegenüberzustellen sind. Nur zögerlich wandten sich Liberale wie Ludwig Erhard, der bekanntlich an wirtschaftlichen Nachkriegsplanungen des NS-Regimes beteiligt war, der modernen Industrie- und Konsumgesellschaft zu.3 Mit Blick auf die Ursprünge und Vorläufer der Integration Westeuropas ist in der Historiographie daher von einem „mehr oder weniger liberalen“ Europa die Rede gewesen, in Abgrenzung von klassischen liberalen Europamodellen.4 Die geläufige These, das NS-Regime sei antieuropäisch und antiliberal gewesen, ist auf Hitler und die Regimeführung konzentriert. Sie vernachlässigt die Politik deutscher Wirtschaftseliten und verkennt solche Integrationsleistungen, die das Regime auch ohne emphatische Berufung auf „Europa“ für sich erzielte. Sie betont Brüche, wo stärker von Kontinuitäten die Rede sein müsste.
Eine spezifisch „westliche“ Vorstellung von Europa hatte in Deutschland vor 1945 freilich einen schweren Stand. Der Verband für Europäische Verständigung des DDP-Mitglieds Wilhelm Heile und andere Vorläufer der nach dem Ersten Weltkrieg zeitweise sehr einflussreichen Europa-Union erhielten wesentliche Impulse von der Locarno-Politik Gustav Stresemanns und Aristide Briands. Die SPD nannte 1926 die „Vereinigten Staaten von Europa“ als Ziel in ihrem Heidelberger Parteiprogramm.5 Dies war keine sozialistische, sondern eine liberale Aussage, die bezeichnenderweise bei den Sozialdemokraten mehr Zustimmung fand als in der DDP und in Stresemanns eigener Partei, der DVP. Die Konzeption westeuropäischer Verständigung geriet seit der Ära Brüning außenpolitisch ins Abseits. Erst viel später trugen die Erfahrungen von politischer Verfolgung und KZ-Haft in der NS-Zeit, namentlich aber der enge Kontakt wichtiger Protagonisten mit dem angelsächsischen Liberalismus im Exil, wesentlich dazu bei, die westeuropäische Integration im politischen Denken der Bundesrepublik zu verankern.6 Die viel zitierte Paneuropa-Bewegung des Grafen Coudenhove-Kalergi hatte nach 1945 hingegen vergleichsweise geringen Einfluss.7 Kurzum: Der „Westen“ kam aus dem Westen nach Deutschland, nicht aus der nationalen Ideengeschichte – so eine weitere geläufige These.
2![]()
Ungleich größere Wirkung entfalteten in der Zwischenkriegszeit Mitteleuropa-Konzepte liberalimperialistischer Provenienz, die ihren handelspolitischen Akzent auf Ostmittel- und Südosteuropa legten.8 Historisch legitimierten sie sich mit der Reichstradition.9 Seit der Ära Brüning schwenkte auch die um die Zeitschrift „Abendland“ gruppierte Bewegung auf die Linie von Mitteleuropa und Reichsnationalismus ein.10 Die Nationalsozialisten nahmen solche europapolitischen Diskurse auf. Vor 1939 propagierten führende Parteifunktionäre wie Alfred Rosenberg ein „germanisches Großreich“, in dem das Deutsche Reich eine „rassische“ Föderation mit seinen Nachbarn bilden sollte. In den faschistischen Kreisen Italiens und Frankreichs wurden solche Visionen aufmerksam registriert.11 Hitler selbst, Himmler und Goebbels wussten aber mit „Europa“ jenseits der Propaganda gar nichts anzufangen und nutzten daher auch nicht die machtpolitischen Möglichkeiten, die sich aus der nationalsozialistischen „Neuen Ordnung“ ab 1940 hätten ergeben können.12

Die Wehrmacht als Drachentöter. Plakat von 1942/44
(Bundesarchiv, Plak 003-028-104)
Der harte Kern ihrer Europaideologie waren Antibolschewismus und Antisemitismus. Bereits das deutsche Propagandamärchen vom Präventivkrieg gegen die Sowjetunion operierte wirksam mit dem angeblichen Abwehrkampf Europas gegen den „jüdischen Bolschewismus“, und dies blieb die Konstante der nationalsozialistischen Berufung auf „Europa“. Sie nahm 1942/43 sprunghaft zu, als Deutschland militärisch in die Defensive geriet. In seiner Sportpalast-Rede vom 18. Februar 1943 malte Goebbels das Schreckgespenst des „jüdischen Bolschewismus“ an die Wand, der den europäischen Kontinent vom Osten her mit Versklavung und Vernichtung bedrohe. Nach der alliierten Invasion vom Juni 1944 betonte die NS-Propaganda erneut den Mythos jüdisch-kapitalistischer Weltverschwörung gegen den Kontinent, der bereits in Hitlers öffentlicher Vernichtungsdrohung vom Januar 1939 eine wesentliche Rolle gespielt hatte.13

„Europa“ schultert Deutschlands Last. Titelbild eines Propagandabuches über die erzwungene Arbeit so genannter Fremdvölkischer im Reich
(Friedrich Didier, Europa arbeitet in Deutschland. Sauckel mobilisiert die Leistungsreserven, Berlin 1943)
Das Bild wird jedoch komplexer, wenn man nach praktisch wirksamer Integration unterhalb und teils gegenläufig zur Ideengeschichte fragt. So ist darauf hingewiesen worden, dass sich das radikalnationalistische Regime zunehmend solcher Begriffe bediente, die den nationalen Bezugsrahmen überschritten: „Reich“, „Rasse“, „Volksgemeinschaft“ und zuletzt „Europa“.14 Die SS, ideologisch zweifellos antieuropäisch, hatte an diesen Vorgängen erheblichen Anteil. Nicht weniger als 24 europäische, zunehmend aber auch nichteuropäische Nationalitäten kämpften als mehr oder weniger Freiwillige in der Waffen-SS, die sich 1945 zu über der Hälfte (etwa eine halbe Million Männer) aus Ausländern und Volksdeutschen zusammensetzte. Die ursprüngliche „nordisch-germanische“ Idee Himmlers führte sich seit 1941 selbst ad absurdum.
3![]()
Die zeitgeschichtliche Forschung des vergangenen Jahrzehnts hat solche Zusammenhänge deutlich herausgearbeitet.15 Ergänzend zur Erforschung der Europapläne und -propaganda rückt nun die Herrschaftspraxis des nationalsozialistischen Europa verstärkt in den Blick. Auf diese Weise tritt die gesamteuropäische Dimension auch der deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg klarer hervor. Sie wirft unter anderem Fragen nach der Mitwirkung ausländischer Akteure und nach transnationalen Dimensionen von Massengewalt auf.16 Neuerdings wurde auf den Versuch der deutschen Kriegsfinanzierung durch Plünderung, Raub und Mord hingewiesen, bei denen die besetzten Gebiete als Geldwaschanlagen fungierten.17 Und auch für den Edelmetallhandel des NS-Staats, der neutrale Länder wie die Schweiz einbezog, ist treffend von einer „Großraubwirtschaft“ die Rede.18 Alles dies waren Formen der Integration Kontinentaleuropas, die mit extremer Gewaltanwendung einhergingen, vielfach aber auf die Mitwirkung einheimischer Eliten aus ideologischen und wirtschaftlichen Interessen heraus zählen konnten.19 Daher ist ein funktionaler Integrationsbegriff unentbehrlich. Auf einige Aspekte dieser Integration soll hier nun näher eingegangen werden; zugespitzt und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
2. Handels- und Währungspolitik im „Neuen Europa“
In der wirtschaftshistorischen Forschung hat die These viel Anklang gefunden, dass der Schuman-Plan von 1950 und die auf ihn gründende Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) von 1952 an Traditionen der Produzenten-Kooperation anknüpften, die in die Zwischenkriegszeit zurückreichen.20 Die größte praktische Wirksamkeit entfaltete in diesem Zusammenhang das Internationale Stahlkartell (ISK) von 1926, ein auf luxemburgische Initiative gegründetes Produktionskartell der Stahlindustrien Deutschlands, des Saarlands, Frankreichs, Luxemburgs und Belgiens, dem auch die Stahlproduzenten Ungarns, Österreichs und der Tschechoslowakei beitraten. Das ISK funktionierte als „Vorläufer umfassender Vereinbarungen zwischen Produzenten und Regierungen, als Instrument der Diplomatie und als Vehikel faktischer wirtschaftlicher Integration“.21 Deutschland trat 1929 aus dem ISK aus; das Stahlkartell – jetzt unter der Bezeichnung Internationale Roheisenexportgemeinschaft – war bis Kriegsbeginn von Großbritannien und (wenn auch inoffiziell) den USA dominiert. 1939 kontrollierte es nicht weniger als 85 Prozent des Weltstahlhandels.22 Die von den Stahlindustriellen angebahnte deutsch-französische Arbeitsteilung lebte im Zweiten Weltkrieg fort.23
Kristallisationskern dieser bei näherem Hinsehen nicht sehr „Neuen Ordnung“ war der so genannte Schlotterer-Ausschuss von 1940, benannt nach dem Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium. Gustav Schlotterer brachte im Anschluss an programmatische Reden seines Vorgesetzten Walther Funk24 Spitzenvertreter der exportorientierten deutschen Großindustrie mit Industriellen und Bankenvertretern aus den Benelux-Staaten ins Gespräch. Man war sich darüber einig, dass der innereuropäische Handel von Zoll- und Währungsgefällen befreit und das Ruhrgebiet mit Nordfrankreich und den Benelux-Ländern zu einem „natürlichen Wirtschaftsraum“ zusammengeschlossen werden solle. Grundlage dessen sei ein privatwirtschaftlich zu organisierendes Produktionskartell unter staatlicher Aufsicht, das Schlotterer als „wirtschaftliches Paneuropa“ bezeichnete.25 Von „Antieuropa“ kann jedenfalls bei diesen Protagonisten kaum die Rede sein. Die EGKS konnte hieran anknüpfen. Die Montanunion hatte eine korporative Vorgeschichte, die das „Dritte Reich“ einschloss.26
4![]()

Aus welcher Zeit mag dieses Foto stammen? Wofür konnte und wofür sollte es stehen? Dies lässt sich nicht aus dem Bildinhalt beantworten, sondern erschließt sich erst durch den Publikationskontext.
(aus: Friedrich Didier, Europa arbeitet in Deutschland. Sauckel mobilisiert die Leistungsreserven, Berlin 1943, S. 10, dort mit der Bildlegende „Stahl für Europas Freiheit“)
Während das ISK einen westeuropäischen Schwerpunkt hatte, war der Mitteleuropäische Wirtschaftstag (MWT) stärker ein Ausdruck deutscher Mitteleuropa-Konzepte. Seit 1931 propagierte der MWT die wirtschaftliche Durchdringung Südosteuropas als Ziel künftiger deutscher Außenpolitik. Mittel-europa von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer müsse langfristig Einflusssphäre des Reiches werden.27 Ab 1936 geriet der MWT zunehmend ins Fahrwasser von Görings Vierjahresplanbehörde, welche die wirtschaftliche Kriegsvorbereitung durch Autarkiepolitik betrieb. Seit 1938 war Deutschland in der Lage, die alte Forderung des MWT umzusetzen, von „Handelsverträge[n] bis zum Wirtschaftsbündnis“ mit Südosteuropa zu schreiten, das auf agrar- und rohstoffwirtschaftlichem Gebiet vollständig vom Reich dominiert wurde.28 Nach der kurzfristigen Wiederbelebung der MWT-Aktivitäten im Umfeld des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts verlor dieses Gremium seit dem Krieg gegen die UdSSR weitgehend an Einfluss. Staatssekretär Schlotterer zeichnete ab Herbst 1940 für die Planungen des Reichswirtschaftsministeriums zur Ausplünderung der Sowjetunion verantwortlich.
Die deutsche Währungspolitik bildete im Zweiten Weltkrieg die Klammer zwischen der Ausbeutung West- und Südosteuropas. Die Abkehr vom Goldstandard durch Großbritannien und die Vereinigten Staaten 1931/33 hatte den multilateralen Kapitalverkehr beendet und die weltweite Bildung von Wirtschaftsblöcken mit jeweils dominierender Leitwährung vorangetrieben. Deutsch-lands Außenhandel wurde im Zeichen der Devisenzwangsbewirtschaftung auf das Clearing von Im- und Exporten auf zweiseitigen Konten bei der Deutschen Verrechnungskasse (DVK) umgestellt, einer Tochtergesellschaft der Reichsbank.29 Bilaterale Handelsverträge waren ein wesentliches Instrument des deutschen Informal empire vor Kriegsbeginn. Sie sollten aus der Not der Weltwirtschaftskrise die Tugend eines deutschen Großwirtschaftsraums machen.
Man frohlockte auf deutscher Seite kurz vor Kriegsbeginn über die „großraumwirtschaftliche Integration“ Südosteuropas durch echte Arbeitsteilung.30 Vor diesem Hintergrund entstanden nach dem deutschen Sieg über Frankreich währungs- und handelspolitische Neuordnungspläne für die Nachkriegszeit, die im schon erwähnten Schlotterer-Ausschuss des Reichswirtschaftsministeriums kontrovers diskutiert wurden. Dem Ausschuss lag unter anderem eine Denkschrift aus der Bankenabteilung des Ministeriums vor, in welcher der Vorschlag gemacht wurde, nach Kriegsende eine Europabank mit Sitz in Wien zu gründen. In mancher Hinsicht weisen diese Überlegungen Parallelen zur heutigen Europäischen Zentralbank auf. Die Mitgliedsländer des Großraums sollten unverkäufliche Aktien der Europabank erwerben, die zur Notendeckung verwendet werden sollten. Die Bank sollte die DVK als zentrale Verrechnungskasse ablösen. Die Verrechnungskurse der Währungen sollte ein Verwaltungsrat festlegen, der auch ermächtigt sein würde, überschuldeten Mitgliedsländern Kredite zu gewähren.31
5![]()
Das Reichswirtschaftsministerium konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Vor allem die Reichsbank hielt eine Europabank für unvereinbar mit den deutschen Interessen. Stattdessen sollte die Deutsche Verrechnungskasse zum Zentrum eines multilateralen europäischen Clearing auf Reichsmarkbasis ausgebaut werden. Angestrebt wurde letztlich eine europäische Währungsunion unter deutscher Hegemonie.32 Am 25. Juli 1940 stellte Reichswirtschaftsminister Funk die Neuordnungspläne der deutschen und ausländischen Presse vor. „Es wird auf Grund der bisherigen schon angewandten Methoden des bilateralen Wirtschaftsverkehrs eine weitere Entwicklung zum multilateralen Wirtschaftsverkehr und zu einem Ausgleich der Zahlungssalden der einzelnen Länder kommen, so daß also auch die verschiedenen Länder über eine solche Clearing-stelle untereinander in geregelte Wirtschaftsbeziehungen treten können“, hieß es dort. Funk warb für eine „bessere Vertretung der europäischen Wirtschaftsinteressen gegenüber anderen wirtschaftlichen Gruppen in der Weltwirtschaft“, selbstverständlich unter deutscher Führung. Allerdings gab der Minister zu verstehen, dass seine Pläne „mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren“ belastet seien; vorerst befinde man sich ja im Krieg.33 Reichsbankvizepräsident Emil Puhl warb noch 1942 für eine „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“, in der das bisherige Zentralclearing durch eine gemeinsame Währung und einen durch Bankkredite finanzierten Außenhandel ersetzt werden könne.34
Der führende britische Nationalökonom John M. Keynes hielt Funks Idee eines multilateralen Zentralclearing für höchst innovativ und riet seiner Regierung davon ab, hierauf mit einem bloßen Bekenntnis zu Freihandel und Goldstandard zu reagieren.35 Der Funk-Plan hinterließ deutliche Spuren in der 1943 publizierten Konzeption Keynes’ für eine Internationale Clearing-Union (ICU) als Grundlage des Welthandels, die bei der Bretton-Woods-Konferenz vom Juli 1944 am Widerstand der Vereinigten Staaten scheiterte.36 Die ICU sollte auf der wechselseitigen Verrechnung mithilfe eines weltweiten Buchgeldes beruhen, des so genannten Bancor, im Übrigen aber auf Geldverkehr verzichten. Andererseits hatte Keynes sofort die Schwachstelle des Funk-Plans gesehen: Die deutsche Kriegsfinanzierung war mit dem angeblich angestrebten Ausgleich von Handelsbilanzen im Großraum unvereinbar. Denn dieser hätte die Reichsmark der innenpolitisch höchst unerwünschten Inflation ausgesetzt und am Ende die deutschen „Partner“ im Großraum gestärkt. Keynes zweifelte daher aus guten Gründen an der Aufrichtigkeit des deutschen Wirtschaftsministers.37
Tatsächlich entwickelte sich das Clearing zu einem Instrument der Kriegsfinanzierung neben anderen. Paradoxerweise beruhte dieser Mechanismus auf einer Politik der bewussten Verschuldung Deutschlands. Denn die Exporteure erhielten ihre Leistungen de facto aus dem Besatzungskostenetat ausgezahlt, wohingegen der Ausgleich der bei der DVK gebuchten Schuldsalden auf die Nachkriegszeit verschoben wurde.38 Man war sich in Berlin einig, dass die europäischen Staaten „mit List, Tücke und vielleicht Gewalt“ dahin gebracht werden müssten, „ihre Waren nach Deutschland zu verkaufen und ihre Salden, wenn sie entstehen, in Berlin stehen zu lassen“.39 Schätzungen über die tatsächliche Höhe der deutschen Clearingverschuldung bei Kriegsende schwanken zwischen rund 30 und 42 Milliarden Reichsmark. Etwa 75 Prozent dieser erzwungenen Kredite stammten aus den besetzten Gebieten, 22 Prozent von verbündeten Staaten, der Rest aus neutralen Staaten wie der Schweiz.40
6![]()
Der Löwenanteil des bei der DVK verbuchten Realtransfers von Leistungen und Gütern kam aus den Staaten der späteren Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).41 Die Forschung hat eine „Intensivierung des intra-industriellen Handels“ im Zweiten Weltkrieg konstatiert, „die in der westdeutschen Handelsbilanz erst in der Mitte der fünfziger Jahre zu beobachten ist. Um 1960 ist auf der Importseite der Fertigwarenanteil ungefähr wieder so hoch wie 1943. […] Die Idee eines Handelsblocks im westlichen Kontinentaleuropa war also Mitte der vierziger Jahre offensichtlich kein Novum mehr.“42 Die Integration der Nachkriegszeit baute auf dieser durchaus westeuropäischen Struktur des integrierten Außenhandels auf, die im NS-Großwirtschaftsraum der Kriegszeit entstanden war.
Ähnliches lässt sich für die Währungspolitik feststellen. Während Hitler und Goebbels Antibolschewismus und Antisemitismus als vermeintliche Bindeglieder Europas propagierten, wandten sich die im so genannten Europa-Kränzchen des Rüstungsministeriums ab 1943 versammelten Industriellen und Bankiers erneut den Währungsplänen Funks zu und modifizierten diese mit Blick auf die alliierten Nachkriegspläne. Über sie war man bestens informiert – durch wiederholte Gespräche zwischen dem schwedischen Chefvolkswirt der in Basel ansässigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Per Jacobsson, und Reichsbankvizepräsident Puhl 1942/43 in Basel und Zürich.43
Im Beirat des Außenhandelsausschusses der Reichsbank wurden die alliierten Währungspläne bereits im Juni 1943 eingehend diskutiert, einschließlich möglicher Lösungen für das Problem der deutschen Clearingverschuldung.44 Im Ergebnis suchten Volkswirtschaftler wie Ludwig Erhard nach Auswegen aus der ruinösen Kriegsfinanzierung auf Kredit. Erhards Denkschrift über Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung nahm 1944 Grundgedanken der Währungsreform vorweg.45 Etwa gleichzeitig schlug der I.G. Farben-Konzern vor, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zur Europabank auszubauen. Diese sollte einen „Europagulden“ als Verrechnungseinheit der beteiligten Währungen aus der Taufe heben, vorerst nur als Buchgeld. Die Denkschrift reagierte auf britisch-amerikanische Kontroversen bei der Konferenz von Bretton Woods. Sie nahm Grundgedanken von Keynes’ Internationaler Clearing-Union auf, um einen Keil zwischen Großbritannien und die USA zu treiben.46
7![]()
Solche Hoffnungen waren natürlich illusorisch. Von erheblicher Bedeutung für den lang anhaltenden Boom der westdeutschen Nachkriegswirtschaft war indes die 1950 auf amerikanischen Druck gegründete Europäische Zahlungsunion (EZU), ein Zusammenschluss mehrerer europäischer Länder unter Einschluss der Bundesrepublik, die durch ein multilaterales Clearingsystem das Problem der so genannten Dollar-Lücke in ihren Volkswirtschaften lösen sollte. Die EZU war ein Instrument des 1948 einsetzenden Marshallplans, der sie finanzierte. Im Unterschied zu den bilateralen Handelsverträgen der NS-Zeit galten hier tatsächlich Prinzipien des multilateralen Clearing, d.h. die Partner waren nicht zum zweiseitigen Ausgleich ihrer Bilanzen gezwungen. Die Clearingzahlungen wurden von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich abgewickelt.47
Technische Anknüpfungen an die Kriegszeit sind nicht zu übersehen. Der Marshallplan zwang die westeuropäischen Empfängerländer zur Rekonstruktion der im Zweiten Weltkrieg aufgebauten Arbeitsteilung, zur Reintegration des besiegten Deutschlands (genauer: der Bundesrepublik) als Wachstumslokomotive in den westeuropäischen Wirtschaftsraum, die Europa auf eigene Füße stellen und von amerikanischer Wirtschaftshilfe mittelfristig unabhängig machen sollte. Wesentliches Mittel dieser Rekonstruktion war die Europäische Zahlungsunion. Sie führte der jungen Bundesrepublik jenes Ausmaß an Vertrauen und Kredit zu, das vom „Dritten Reich“ verspielt worden war.48
3. Massenmord und Währungsstabilisierung
Die Geldströme der deutschen Kriegsfinanzierung liefen beim Reichsfinanzministerium zusammen, das ein weiterer, lange unterschätzter Akteur europäischer Integration war. Diese beschränkte sich nicht auf Westeuropa, sondern schloss territorial Ost- und Südosteuropa, finanziell die Erträge deutscher Massenmorde ein.49 Der Zusammenhang zwischen Besatzungspolitik, Finanzwirtschaft und Vernichtungspolitik ist eindrucksvoll am griechischen Beispiel belegt, obwohl auch in anderen deutschen Besatzungsgebieten das jüdische Vermögen im deutschen Interesse „vor Ort“ nationalisiert und zu Geld gemacht wurde.50
8![]()
Das neutrale Griechenland wurde im Oktober 1940 von Italien angegriffen, das sein mediterranes Imperium erweitern wollte. Griechische Truppen trieben den Aggressor bis Albanien zurück. Ab April 1941 besetzte die Wehrmacht das Land, das in eine deutsche, eine italienische und eine bulgarische Besatzungszone aufgeteilt wurde. Bis zum Abzug der Besatzer 1944 kamen etwa 300.000 Griechen ums Leben, davon etwa je 100.000 durch eine Hungersnot, die im Winter 1941/42 ihren Höhepunkt fand, und bei deutschen Aktionen gegen linksgerichtete Partisanen; weitere mindestens 65.000 Personen waren Opfer der Judenvernichtung.51 Hinzu kamen Flüchtlingsbewegungen und Zwangsumsiedlungen größten Ausmaßes, von denen etwa eine Million Menschen betroffen waren.52 Christian Gerlach hat vorgeschlagen, die Ermordung der griechischen Juden in die gesellschaftlichen und ökonomischen Ursachen der Gewalt-geschichte Griechenlands zwischen 1912 und 1974 einzuordnen, namentlich in den säkularen Prozess der Verdrängung und Ermordung religiöser Minderheiten (Muslime und Juden) sowie des Aufstiegs einer griechisch sprechenden kommerziellen Elite. Vor diesem Hintergrund stellt sich die militärische Besetzung des Landes im Zweiten Weltkrieg auch als ökonomischer Umschichtungsprozess dar.53
Deutschland und Italien erlegten dem Land hohe Besatzungskosten und Kontributionen auf. Zudem werteten sie die griechische Drachme ab. Das führte zwangsläufig zur Inflation. Diese trug maßgeblich zum Ausbruch der Hungersnot von 1941 bei, die ihrerseits den kommunistischen Widerstand zur Massenbewegung machte. Andererseits erschwerten Inflation und Hunger die Mobilisierung des griechischen Arbeitskräftepotenzials für den Berg- und Straßenbau. Hitlers anfängliche Würdigung der Griechen als tapfere Soldaten und „rassisch wertvolle“ Nachfahren der Hellenen wich aus diesem Grund einer ebenso ostentativen Ablehnung der Griechen als angebliche „Nichtstuer, Schieber und Korrupteure“. Das war eine deutsche Erfindung des Jahres 1943.54
Auch der Antisemitismus wurde geschürt, beginnend mit einer Kampagne der im April 1942 von der deutschen Besatzungsmacht erstmals aufgelegten Zeitung „Neues Europa“.55 Wie in allen osteuropäischen Besatzungsgebieten wurden Juden als Schwarzmarkthändler und Partisanenhelfer stigmatisiert. Obgleich griechische Kollaborateure 1942/43 in den deutschen Hymnus von der „Neuordnung“ des Kontinents einstimmten, war die Brutalität der NS-Besatzungspolitik nicht dazu angetan, für diese Politik zu werben. Sie verstärkte vielmehr den griechischen Widerstand.56
9![]()
Seit Oktober 1942 bemühte sich die deutsche Militärverwaltung, das griechische Inflations- und Arbeitsmarktproblem in den Griff zu bekommen – letzteres durch den Übergang zur allgemeinen Arbeitspflicht. Dieser Versuch scheiterte im März 1943. Ausgerechnet jetzt begann die Deportation der Juden aus Saloniki und der bulgarischen Zone, die in enger Zusammenarbeit zwischen Militärverwaltung und Reichssicherheitshauptamt durchgeführt wurde. Das bewegliche Eigentum der nach Auschwitz verschleppten Juden von Saloniki, insgesamt etwa 45.000 Personen, wurde auf deutsche Weisung von einer griechischen „Dienststelle zur Verwaltung des Judenvermögens“ beschlagnahmt, an der Athener Börse in Gestalt von 12 Tonnen Gold an griechische Staatsangehörige verkauft und der Erlös dem deutschen Besatzungskostenetat gutgeschrieben. So stabilisierte sich der Kurs der griechischen Drachme bis August 1943.57
4. Weiterführende Überlegungen
Die nationalsozialistische Hegemonial- und Besatzungspolitik in Europa bezog wesentliche Impulse aus der Aufnahme und Fortschreibung von Diskursen über den Kontinent, die auf den Ersten Weltkrieg zurückführen. Insbesondere das vage „Mitteleuropa“-Konzept war anschlussfähig, sowohl für den Reichsmythos als auch für die spezifisch nationalsozialistische Variante einer deutsch geführten Föderation. Letztere wurde niemals verwirklicht. Stattdessen installierte Deutschland eine rassistisch abgestufte Herrschaftsordnung über den Kontinent, die partiell transnationalen Prinzipien folgte, in wesentlichen Hinsichten aber nationalstaatliche Hierarchien befestigte oder verschob.
Daher gab es deutliche Unterschiede zwischen den hoch industrialisierten Besatzungsgebieten Frankreichs und der Beneluxländer einerseits, den von Nationalsozialisten oft als „Ergänzungsräume“ titulierten Staaten Ost- und Südosteuropas andererseits. In Westeuropa fielen Ideologie und Praxis der deutschen Großraumwirtschaft in Teilen auf fruchtbaren Boden, weil es Anknüpfungspunkte aus der Zwischenkriegszeit gab. In Osteuropa war die deutsche Besatzungspolitik wirtschaftlich destruktiv. Dort konnte der NS-Staat kaum auf industriewirtschaftliche Arbeitsteilung setzen. Die exportierte Inflation der Reichsmark gefährdete vielmehr die eigene Besatzungspolitik. In Griechenland musste das Vermögen der ermordeten Juden dazu herhalten, die selbst herbeigeführte Hyperinflation kurzfristig einzudämmen. Gleichzeitig verschärfte die Politik der nationalen „Verwertung“ die gesellschaftlichen Konflikte im Land und trug zur Gewalteskalation bei.
10![]()
Der Verrechnungsverkehr reagierte auf die Krise des liberalen Welthandels ab 1931. Trotz wirtschaftspropagandistischer Bekenntnisse zum Multilateralismus hielt Deutschland bis Kriegsende eisern am zweiseitigen Verrechnungsverkehr fest und unternahm keine ernsthaften Anstrengungen, die propagierte Gemeinschaftswährung auch tatsächlich zu schaffen. Hellsichtigen deutschen Ökonomen war ab 1943 klar, dass die deutsche Clearingverschuldung über kurz oder lang auf die Reichsmark zurückschlagen würde. Sie waren aber weder willens noch in der Lage, das Steuer der Kriegsfinanzierung herumzuwerfen oder die währungspolitischen Zügel in der „Festung Europa“ zu lockern.
Gleichwohl weisen die ambitionierten Pläne Funks und seiner Epigonen über das Kriegsende hinaus. Sie nahmen in Teilen die heutige Gemeinschaftswährung gedanklich vorweg. Finanztechnisch beruhten sie auf dem durchaus modern anmutenden Instrument des multilateralen Clearing. Deutsche und alliierte Vertreter kommunizierten während des Kriegs regelmäßig in der neutralen Schweiz über die Weltwährungsordnung der Nachkriegszeit. Dies trug dazu bei, dass Funks Konzepte, gewissermaßen britisch-amerikanisch geläutert, nach Westeuropa zurückkehren und dort in Gestalt der Europäischen Zahlungsunion positive Wirkungen entfalten konnten.58 Die historische Forschung sollte aber bei diesem interessanten Aspekt von Westernisierung59 nicht stehenbleiben, sondern den Zusammenhang von West- und Osteuropa unter deutscher Herrschaft systematisch in den Blick nehmen. Eine Aufgabe künftiger Historiographie über die europäische Integration kann folglich darin bestehen, Westernisierung und beispiellose Plünderungsorgien des NS-Regimes auf dem ganzen Kontinent zusammenzudenken.

Aufbruch nach Europa: Apokalypse oder Motorisierung? Die Konsumgesellschaft als nationalsozialistische Zukunftsvision („Bolsevizm“ versus „Novaja Evropa“). Propagandaplakat von 1943
(Bundesarchiv, Plak 003-040-051)
1 Wolfgang Schmale, Geschichte Europas, Wien 2000, S. 116.
2 Mareike König/Matthias Schulz, Die Bundesrepublik und die europäische Einigung: Trends und Kontroversen der Integrationshistoriographie, in: dies. (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland und die europäische Einigung 1949–2000. Politische Akteure, gesellschaftliche Kräfte und internationale Erfahrungen, Stuttgart 2004, S. 15-36, hier S. 18, gegen: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 18 (2002): Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920–1960, hg. von Thomas Sandkühler.
3 Ludolf Herbst, Der Totale Krieg und die Ordnung der Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda 1939–1945, Stuttgart 1982, S. 421-433; Paul Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert, München 2000, S. 297f.
4 John Gillingham, European Integration, 1950–2003. Superstate or New Market Economy?, Cambridge 2003, S. 6-52.
5 Obgleich sich im Heidelberger Programm auch Anklänge an zeitgenössische Mitteleuropa-Diskurse finden, hob die SPD die Verständigung mit England und den USA deutlich hervor: Das Heidelberger Programm. Grundsätze und Forderungen der Sozialdemokratie, Berlin 1926, S. 65, S. 69f.
6 Vanessa Conze, Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reichstradition und Westorientierung (1920–1970), München 2005, S. 211-218, S. 232-242.
7 Ebd., S. 196-203; anders Schmale, Geschichte Europas (Anm. 1), S. 110ff.
8 Vgl. Jürgen Elvert, Mitteleuropa! Deutsche Pläne zur europäischen Neuordnung (1918–1945), Stuttgart 1999, S. 21-26.
9 Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, Bd. 2: Deutsche Geschichte vom „Dritten Reich“ bis zur Wiedervereinigung, 5. Aufl. München 2002, S. 645-648.
10 Conze, Europa (Anm. 6), S. 27-57.
11 Elvert, Mitteleuropa! (Anm. 8), S. 330-352. Vgl. auch den Beitrag von Robert Grunert in diesem Heft.
12 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949, 3. Aufl. München 2008, S. 925; vgl. Mark Mazower, Hitlers Imperium. Europa unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, München 2008, S. 17f., S. 119-122, S. 227-230, S. 254-260.
13 Christian Gerlach, Die Wannseekonferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden, in : WerkstattGeschichte 18 (1997), S. 7-44.
14 Kiran Klaus Patel, Der Nationalsozialismus in transnationaler Perspektive, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 49 (2004), S. 1123-1134, hier S. 1129.
15 Elvert, Mitteleuropa! (Anm. 8); mit Abstrichen auch Birgit Kletzin, Europa aus Rasse und Raum. Die nationalsozialistische Idee der Neuen Ordnung, Münster 2000; Conze, Europa (Anm. 6); Mazower, Hitlers Imperium (Anm. 12), S. 525f.; Hans-Erich Volkmann, Zur europäischen Dimension nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik, in: ders., Ökonomie und Expansion. Grundzüge der NS-Wirtschaftspolitik, hg. von Bernhard Chiari, München 2003, S. 19-44; zuletzt Marcel Boldorf, Neue Wege zur Erforschung der Wirtschaftsgeschichte Europas unter nationalsozialistischer Hegemonie, in: ders./Christoph Buchheim (Hg.), Europäische Volkswirtschaften unter deutscher Hegemonie 1938–1945, München 2012, S. 1-26.
16 Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 19 (2003): Kooperation und Verbrechen. Formen der „Kollaboration“ im östlichen Europa 1939–1945, hg. von Babette Quinkert, Christoph Dieckmann und Tatjana Tönsmeyer; Patel, Nationalsozialismus (Anm. 14).
17 Götz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 2006.
18 Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Die Schweiz und die Goldtransaktionen im Zweiten Weltkrieg. Überarbeitete und ergänzte Fassung des Zwischenberichts von 1998, Zürich 2002; Ralf Banken, Edelmetallhandel und Großraubwirtschaft. Die Entwicklung des deutschen Edelmetallsektors im „Dritten Reich“ 1933–1945, Berlin 2009.
19 Mazower, Hitlers Imperium (Anm. 12), S. 383-430; Christian Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften. Massengewalt im 20. Jahrhundert, München 2011.
20 Matthias Kipping, Kontinuität oder Wandel? Der Schuman-Plan und die Ursprünge der wirtschaftlichen Integration in Europa, in: Stephen A. Schuker (Hg.), Deutschland und Frankreich. Vom Konflikt zur Aussöhnung. Die Gestaltung der westeuropäischen Sicherheit 1914–1963, München 2000, S. 211-230, hier S. 211f. (mit weiterer Literatur).
21 John Gillingham, Zur Vorgeschichte der Montan-Union. Westeuropas Kohle und Stahl in Depression und Krieg, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 34 (1986), S. 381-405, hier S. 381.
22 Ders., Solving the Ruhr Problem. German Heavy Industry and the Schuman-Plan, in: Klaus Schwabe (Hg.), Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51. Beiträge des Colloquiums in Aachen, 28.-30. Mai 1986, Baden-Baden 1988, S. 399-436, hier S. 406f.
23 Ders., Vorgeschichte (Anm. 21), S. 381f., S. 404f.
24 Funk war in Personalunion Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident.
25 Gillingham, Vorgeschichte (Anm. 21), S. 401f.
26 Annie Lacroix-Riz, Frankreich und die europäische Integration. Das Gewicht der Beziehungen mit den Vereinigten Staaten und Deutschland, 1920–1955, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 18 (2002), S. 145-194, hier S. 158-161, S. 177-187.
27 Martin Seckendorf, Der Mitteleuropäische Wirtschaftstag – Zentralstelle der Großwirtschaft zur Durchdringung Südosteuropas, in: Werner Röhr/Brigitte Berlekamp/Karl Heinz Roth (Hg.), Der Krieg vor dem Krieg. Politik und Ökonomie der „friedlichen“ Aggressionen Deutschlands 1938/39, Hamburg 2001, S. 118-140; Elvert, Mitteleuropa! (Anm. 8), S. 203-217.
28 Hans-Erich Volkmann, Die NS-Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges, in: Wilhelm Deist u.a., Ursachen und Voraussetzungen des Zweiten Weltkrieges, Frankfurt a.M. 1995, S. 211-435, hier S. 401-411; Zitat Wilmowsky (Vorsitzender des MWT) ebd., S. 402.
29 Zwischen den Vertragspartnern fand kein Devisenverkehr statt. Vielmehr erhielt der Exporteur seine Rechnung in eigener Währung ausgezahlt, während der deutsche Importeur in Reichsmark einzahlte. Die bei der DVK gebuchten Salden sollten jedenfalls theoretisch in regelmäßigen Abständen durch Devisen, Goldtransfers oder Exportleistungen ausgeglichen werden. In der Praxis war dies nicht der Fall; vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt.
30 Volkmann, NS-Wirtschaft (Anm. 28), S. 408-411. Zum Clearing bis Kriegsbeginn vgl. Marc Buggeln, Währungspläne für den europäischen Großraum. Die Diskussion der nationalsozialistischen Wirtschaftsexperten über ein zukünftiges europäisches Zahlungssystem, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 18 (2002), S. 41-76, hier S. 43-47.
31 Ebd., S. 56f.
32 Ebd., S. 61-63.
33 Walther Funk, Wirtschaftliche Neuordnung Europas (Rede vom 25.7.1940), in: Südost-Echo, 26.7.1940.
34 Harold James, Post-War German Currency Plans, in: Christoph Buchheim/Michael Hutter/Harold James (Hg.), Zerrissene Zwischenkriegszeit. Wirtschaftshistorische Beiträge, Baden-Baden 1994, S. 205-218, hier S. 208. Zur selben Zeit nahm die Reichsbank die ersten Lieferungen von Zahngold durch die SS in Empfang, das ermordeten Juden geraubt worden war. Puhl wusste hierüber genau Bescheid; vgl. zuletzt Banken, Edelmetallhandel (Anm. 18), S. 706-715.
35 Marc Buggeln, Europa-Bank oder Dollar-Freihandel? Westdeutsche Auseinandersetzungen über eine Europäische Währungsunion zu Beginn der fünfziger Jahre, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 18 (2002), S. 127-144, hier S. 131f.; zur Rezeption des Funk-Plans vgl. James, Currency Plans (Anm. 34), S. 208.
36 Ebd., S. 208f., S. 214ff.
37 Ebd., S. 216; vgl. Gillingham, European Integration (Anm. 4), S. 19ff.
38 Aly, Hitlers Volksstaat (Anm. 17), S. 93-113; Boldorf, Neue Wege (Anm. 15), S. 14ff.
39 Schlotterer, 11.7.1940; zit. nach Buggeln, Währungspläne (Anm. 30), S. 60f.
40 Willi A. Boelcke, Die Kosten von Hitlers Krieg. Kriegsfinanzierung und finanzielles Kriegserbe in Deutschland 1933–1948, Paderborn 1985, S. 108-114.
41 Ende 1944 summierte sich nach Berechnungen des Reichswirtschaftsministeriums die deutsche Clearingverschuldung gegenüber den späteren EWG-Staaten auf rund 19,6 Milliarden Reichsmark, gegenüber den skandinavischen Staaten auf rund 1,4, gegenüber Südosteuropa auf rund 4,0 und gegenüber Osteuropa auf rund 4,8 Milliarden Reichsmark: Helge Berger/Albrecht Ritschl, Die Rekonstruktion der Arbeitsteilung in Europa. Eine neue Sicht des Marshallplans in Deutschland 1947–1951, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 43 (1995), S. 473-519, hier S. 495; vgl. auch Boelcke, Kosten (Anm. 40), S. 111.
42 Berger/Ritschl, Rekonstruktion (Anm. 41), S. 496f.
43 Wolfgang Schumann, Probleme der deutschen Außenwirtschaft und einer „europäischen Wirtschaftsplanung“ 1943/44, in: Studia Historiae Oeconomicae 14 (1979), S. 141-160, hier S. 146-149; zu Jacobssons Unterredungen vgl. James, Currency Plans (Anm. 34), S. 210f.
44 Ebd., S. 212f.; zur Finanzlage 1944 auch Adam Tooze, Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München 2007, S. 734-742.
45 Herbst, Der Totale Krieg (Anm. 3), S. 423-433; Olaf Breker, Ordoliberalismus – Soziale Marktwirtschaft – Europäische Integration. Entwicklungslinien einer problematischen Beziehung, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 18 (2002), S. 99-126, hier S. 102f., S. 108ff.
46 Buggeln, Europa-Bank (Anm. 35), S. 132.
47 Alan S. Milward, The Reconstruction of Western Europe, London 1984, S. 320-334; Barry Eichengreen, Reconstructing Europe’s Trade and Payments. The European Payments Union, Manchester 1993.
48 Berger/Ritschl, Rekonstruktion (Anm. 41), S. 499-502, S. 518f.
49 Vgl. Aly, Hitlers Volksstaat (Anm. 17). Die heftige Kontroverse um Alys These einer nationalsozialistischen „Gefälligkeitsdiktatur“ sollte nicht den Blick dafür verstellen, dass der Autor in zuvor unerreichter Präzision die Techniken der „Verwertung“ jüdischen Eigentums im Herkunftsland der Opfer und der Transferierung ihrer Erträge zum deutschen Fiskus dargestellt hat.
50 Vgl. für Ungarn die Befunde bei Christian Gerlach/Götz Aly, Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944/45, München 2002, S. 186-239.
51 Hagen Fleischer, Griechenland, in: Wolfgang Benz (Hg.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1996, S. 241-274; Hans Safrian, Eichmann und seine Gehilfen, Frankfurt a.M. 1997, S. 225-260, S. 270-284, S. 287-292.
52 Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften (Anm. 19), S. 319.
53 Ebd., S. 333-337.
54 Ebd., S. 319f.
55 Fleischer, Griechenland (Anm. 51), S. 246.
56 Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece. The Experience of Occupation, 1941–1944, New Haven 2001, S. 79-84.
57 Fleischer, Griechenland (Anm. 51), S. 254; Aly, Hitlers Volksstaat (Anm. 17), S. 283-299.
58 Volkmann, Zur europäischen Dimension (Anm. 15), S. 41f.
59 James, Currency Plans (Anm. 34), S. 216f. („The Birth of Liberalism“). Zum Konzept der Westernisierung vgl. Anselm Doering-Manteuffel, Amerikanisierung und Westernisierung, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 18.1.2011, online unter URL: http://docupedia.de/zg/Amerikanisierung_und_Westernisierung
![]()







































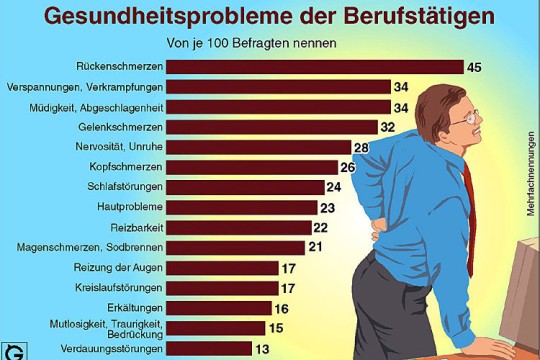











3 Antworten zu Frühes Trauma — Hauptrisiko für psychische Störungen
Alarmistischer Unsinn.
Oha!
Da würd ich doch gern Begründungen, Belege, Hinweise erfahren.
Nach meinen Kenntnissen sind die Artikelinformationen aktueller Stand der Tiefenpsychologie.
Und welche Instanz soll es denn sein, die diesen angeblichen “aktuellen Stand” bestimmt? Der Alarmismus wird betrieben durch die Psychokratie, um immer mehr Geld für eigene Betreuungsindustrie zu fordern. Bald wir jeder als traumatisiert bezeichnet, alleine durch das postulierte “Geburtstrauma”. “Begründungen, Belege, Hinweise” kann ich gerne für ein angemessenes Angebot erarbeiten und liefern.
https://kreidfeuer.wordpress.com/2015/05/20/fruehes-trauma-hauptrisiko-fur-psychische-stoerungen/
Psycho-Boom: Alle entdecken die Seele
Remschmidt, Helmut
Wer heute psychisch krank wird oder einen Familienangehörigen hat, der an Angstzuständen, Depressionen oder Zwängen leidet, der gerät in eine schwierige Situation. Nicht nur, weil seelische Krankheit eine große Belastung bedeutet, sondern auch, weil er sich einer Vielzahl von Helfern gegenübersieht, die ihm ihre Dienste anpreisen und deren Therapiemethoden kaum ein Insider mehr voneinander unterscheiden kann. Denn es wird viel geboten: Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie, autogenes Training, Gestalttherapie, Bioenergetik, Selbsterfahrung, Transaktionsanalyse, biorhythmische Behandlung, Alpha-Tiefenentspannung, Rebirth-Meditation, Hypnose, verschiedene Formen der Gruppen- und Familientherapie. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Wenn er betucht ist und nicht ganz schwer krank, so kann er sich aussuchen, wo diese Behandlung stattfindet: im Rahmen eines Workshops in Südfrankreich, in einem Sommer-Kibbuz in Norwegen, in einer Intensivgruppe auf Santorini, auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer oder auch im Rahmen eines Urlaubs irgendwo, freilich unter erfahrener psychotherapeutischer Leitung.
Ist er so schwer krank, dass eine Behandlung in so angenehmer Umgebung ausscheidet, so wird es für ihn nicht leichter, den „richtigen Therapeuten“ zu finden. Denn er hat gelesen, dass es zahlreiche Therapeuten gibt: zunächst verschiedene Ärzte, Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater, Fachärzte für psychosomatische Medizin, Neurologen, Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie oder Psychoanalyse, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Soziotherapeuten, Milieutherapeuten, ausgebildete oder nicht ausgebildete Psychotherapeuten verschiedenster Ausrichtung. Die Bezeichnung Psychotherapeut ist ja nicht geschützt.
Ist er so schwer krank, dass er verwirrt ist oder, wie es in den Unterbringungsgesetzen heißt, „dass er sich selbst oder andere gefährdet“, so reduziert sich plötzlich die Vielfalt der möglichen Therapien und der Therapeuten, und er wird von seinem Hausarzt in das nächstgelegene psychiatrische Krankenhaus mit Versorgungsauftrag eingeliefert, das verpflichtet ist, ihn aufzunehmen und zu behandeln. Gegenüber diesem Krankenhaus entlädt sich dann oft die Empörung der Familie, der Nachbarn, und oft manch anderer Therapeuten, die mit dem Patienten „stark mitfühlen“, der jedoch aufgrund der Schwere seines Krankheitsbildes leider ihre Behandlungsmöglichkeiten überschreitet. So entsteht die paradoxe Situation, dass gerade dann, wenn die Not am größten ist, die Helfer fehlen. Sie sind nicht sichtbar, nicht zuständig oder weit entfernt, zum Beispiel auf Santorini. Stattdessen wird aber jenen Krankenhäusern, die die harte Arbeit der Erst- und Primärversorgung leisten, ständig geraten, was sie tun sollen. Vielfach wird den Mitarbeitern psychiatrischer Krankenhäuser auch Supervision von außen angeboten, von Kollegen, die die alltägliche Arbeit nicht oder nicht mehr kennen. Sie werden auf zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht, die viel Geld kosten und die häufig mit ihrer täglichen Arbeit kaum etwas zu tun haben.
Wir leben in einer Zeit des Psycho-Booms, in einer Zeit, in der jeder die Seele entdeckt hat, in einer Zeit, in der sehr Viele Therapeuten sein wollen, auch Angehörige wichtiger Berufe wie Krankenschwestern und Pfleger, Pädagogen, Sonderpädagogen oder Sozialarbeiter, die eigenständige Aufgaben in ihrem gelernten Arbeitsfeld zu erfüllen haben. Man muss sich fragen, woher diese Werteverschiebung kommt: die Entwertung vieler traditioneller und wichtiger Berufe und die Aufwertung aller Tätigkeiten, die sich mit der Bezeichnung Therapie oder Psychotherapie zieren. Man kann diese Entwicklung sicherlich nicht nur als Mode abtun. Die zahlreichen Helfer, die auffällig und unverhohlen für sich werben, erzeugen sicher auch einen Bedarf, kommen aber ebenso auch Bedürfnissen entgegen. Die arbeitsteilige Welt, die Reduktion der Familie auf die Kernfamilie von Eltern und Kindern, Lebensabschnittspartnerschaften, die Entwertung religiöser Bindungen, die Verdünnung zwischenmenschlicher Beziehungen, die hohen sozialen Ansprüche, auch die technische Entwicklung haben zu einer Art neuer Bekenntnisfreude geführt. Bei dieser Dominanz der Selbstbezogenheit gehört es dazu, sich selbst zu beobachten, über Symptome zu klagen, zu bekennen, dass man Angst hat, an Arbeitsstörungen leidet und sich deshalb nicht weiterentwickeln kann. Das Ganze geschieht, jedenfalls bei vielen, in einer Situation materiellen Abgesichertseins. Diese Einstellung wird einem dann auch täglich von den vielen Helfern bestätigt: Allgemeine Lebensprobleme werden zu Krankheiten gemacht, Schwierigkeiten, an denen man wachsen kann, werden zu Behandlungsfällen.
Was wir brauchen, ist wieder die Zusammenführung erprobter Therapiemaßnahmen und die Ausgliederung jener, für die es keinerlei Wirksamkeitsnachweise gibt. Was wir brauchen, ist eine ärztliche Ausbildung, die notwendiges Spezialwissen und die Verpflichtung zur Übersicht zu vereinbaren weiß.
http://www.aerzteblatt.de/archiv/136526/Psycho-Boom-Alle-entdecken-die-Seele#comments
Psychokratie
Autor: Wolfram Pfreundschuh
Psychokratie heißt Seelenherrschaft und meint gesellschaftliche Verhältnisse, die es einer auf irgendeiner materiellen Ebene vermögenden Klasse erlauben, die psychischenBeziehungen oder Nöte von Menschen für ihre Interessen zu nutzen, indem sie diese durch psychische Kräfte handhaben (siehe Psyche). Für solche Herrschaftsform ist eine Lebensstruktur vorausgesetzt, in welcher psychische Abhängigkeiten erzeugt und vertieft werden, die durch geistige Manipulationen oder Einverleibungen den Menschen ein Verhalten aufzwingen, das zum eigenen Machterhalt erwünscht ist und deren Ohnmacht auf sie zurückwirft und vermehrt z.B. durch Populismus, Täuschung, Hörigkeit oder Sucht. (siehe auch Tittytainment).
Das setzt voraus, dass Menschen durch psychische Beeindruckung in ihre Lebensräumen (siehe auch Lebensburg) diesen Interessen schon durch Gewöhnung oder institutionelle Macht unterworfen sind. Ihr Leben kann dieser nur einverleibt werden, weil schon darin ein psychisches Machtgefälle besteht, das den Absichten einer beherrschenden Seite Macht über Bedürfnisse verleiht, welche die Ohnmacht der anderen für sich produziert und potenziert, indem sie diese erzieht (siehe erzieherische Beziehung) und in ihrer Anleitung über ihre Medien – z.B. Presse, Unterhaltung, Haushalt, Religion, Kult oder Gemeinsinn – psychisch lenkt und sie darin zu leiten und zu beherrschen oder auch zu unterdrücken versteht (siehe hierzu z.B. auch Sekte, Familie).
Auf der anderen Seite unterstellt dies Menschen, die aus sich heraus kein eigenes Verlangen nach wirklicherGegenständlichkeit, keine wirklichen Bedürfnisse mehr bilden können, weil sie diese nicht erkennen können, weil sie schon allgemein von unwirklich wirkenden Kräften beherrscht sind. Das Unvermögen kann zur Bestimmung werden und verdient alle Aufmerksamkeit. Vor allem darf es nicht zum Vorwurf einer bloßen Moral oder aus einem Imperativ heraus, also durch eine Gedankenabstraktion verdreht werden.
Denn ohne eine solche Erkenntnis müssen Menschen sich schon im Selbstbehelf zu einer Masse (siehe Massenmensch) in einer Gesellschaftsform vermengen, deren Zusammenhang durch fremde Kraft (siehe auch Entfremdung), im Allgemeinen durch Geldbesitz bestimmt ist, deren existenzielle Macht nicht unbedingt unmittelbar wirkt, aber durch Probleme des Finanzsystems, durch Staatsverschuldung und Machtpolitik manifest ist (siehe hierzu auch Dienstleistungesellschaft). Darin treten die Menschen lediglich als Humankapital auf, das entsprchend bearbeitet, zur Funktion für das Ganze gebracht werden muss, um ein feudalkapitalistisches System zu stabilisieren.
Die Macht über diese beruht auf der Transformation von Seligkeiten des Selbsterlebens, die solchen Massemenschen durch Kulturkonsum (z.B. durch Tittytainment) ermöglicht werden (s.a. Massenpsyche). Die Mittel hierfür bieten die öffentlichen und privaten Medien, die Regenerations– und Gesundheitsindustrie, Sekten oder auch teilweise „fast seriöse Psychologie“, wie sie z.B. nach Anwendung von Hellinger geboten wird. Die Unterhalter, Munter- und Gesundmacher stellen sich wie ein „Großer Bruder“ des Betroffenen ihm zur Seite und behandeln ihn mit psychologischen und oft auch mit esoterischen Beratungen, um ihn zugleich über sich hinaus zutragen und mit einer Allgemeinseele zu vervollständigen (siehe auch Volksseele), die eine lebensleitende Funktion bekommt und dem Betroffenen als seelische Prothese, als Ergänzungsseele dient. Weil sie mystifizierten Inhalten folgt und oft selbst nurmehr abergläubisch agiert, sind Menschen damit auch mit minimalem Aufwand beliebig zu leiten.
http://kulturkritik.net/begriffe/begr_txt.php?lex=psychokratie
Die Entstehung der Psychokratie aus dem Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft
“Das Individuum ist substantiell und real;
die Gesellschaft ist lediglich ein Bezugsgeflecht”.
Bhagwan Shreee Rajneesh
“Der politische Staat verhält sich ebenso spiritualistisch
zur bürgerlichen Gesellschaft wie der Himmel zur Erde”.
Karl Marx
Die Dialektik kapitalistischer Vergesellschaftung, die den Menschen als egoistischen Bourgeois und als an Vernunft und wahrem Gemeinwohl interessierten Citoyen zugleich setzt, drängt nach ihrer Selbstaufhebung. Die sich anbahnende repressive Versöhnung von Gesellschaft und Staat, von Privatmann und Staatsbürger, zielt auf neue Unmittelbarkeit. Am Ende der Emanzipation aus der Unterjochung durch Natur droht die nicht weniger grausame Versklavung durch die zur zweiten Natur werdende Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft dementiert das Versprechen ihres historischen Kampfes gegen den Feudalismus, sie revidiert das Versprechen der Aufhebung von Herrschaft durch den Verein freier Bürger: Nur das Ende persönlicher Willkür soll gemeint gewesen sein. Fortschritt bestünde so einzig in der Anonymisierung von Herrschaft, in ihrer Verwandlung in ’Sachnotwendigkeiten‘ der gesellschaftlichen Reproduktion. Herrschaft würde so nur aufgehoben, um sie zu verewigen. Selbst der Tyrannenmord schüfe keine Freiheit mehr, sondern nur den Austausch des Herrschaftspersonals. Ein neuer Naturzustand stünde am Ende von ’Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit‘. Der begeisterte Skeptiker der bürgerlichen Revolution, Jean-Jacques Rousseau, hat früh antizipiert, worin die Dialektik der Selbsterhaltung, die den Ausbruch aus dem Naturgefängnis ermöglichte, enden kann: “Der immer rege Bürger schwitzt, hastet und quält sich auf der Suche nach immer mühsameren Beschäftigungen unaufhörlich. Bis zu Tode arbeitet er, ja er rennt ihm sogar entgegen, nur um sein Leben bestreiten zu können, oder er verzichtet auf das Leben, um die [ 1 ] Anstelle des guten Lebens, das Arbeit ermöglichen sollte, tritt endlose Arbeit noch ohne Hoffnung auf Heimzahlung durchs Jenseits; anstatt Luxus und Genuß zu verallgemeinern, zerstört die losgelassene Produktion die Fähigkeit, Genuß und Barbarei zu unterscheiden: Selbsterhaltung ohne Selbst verwandelt die Menschen in lebende Leichname, die die Funktionsstellen des produktiven Apparates nur bekleiden, nicht aber diesen bestimmen. Die prinzipielle Oberflüssigkeit der Einzelnen fürs Resultat der Produktion läßt unter ihnen das Recht des Stärkeren wiederauferstehen: “Hier ist alles auf das alleinige Recht des Stärkeren zurückgeworfen und folglich auf einen neuen Naturzustand, aber ganz verschieden von dem, mit dem wir begonnen haben”. Die bürgerliche Gesellschaft realisiert wirkliche Freiheit, schreibt Rousseau, aber nur als negative: “Hier werden [ 2 ]
Repressive Gleichheit hebt den Unterschied zwischen Privatmann und Staatsbürger auf, eine Gleichschaltung, die deren Verhältnis nicht allein umkehrt, es vielmehr gänzlich überschreitet: “Statt daß die Subjekte sich in der allgemeinen Angelegenheit vergegenständlichen”, so hatte Marx das Staatsrecht Hegels kritisiert, “läßt Hegel die ’allgemeine Angelegenheit‘ zum ’Subjekt‘ kommen. Die Subjekte bedürfen nicht der ’allgemeinen Angelegenheit‘ als ihrer wahren Angelegenheit, sondern die allgemeine Angelegenheit bedarf der Subjekte zu ihrer [ 3 ] Der Staat, der Verein der freien Bürger ist nicht deren Mittel zum Zweck des guten Lebens, sondern der Staatszweck, wie er von der Staatsbürokratie formuliert wird, bedarf der Bürger als seines Mittels, seine Pläne aus der Amtsstube in die Wirklichkeit zu setzen. Damit ist der Staatsbürger nur der lebendige Agent, die empirische Existenz der Staatsidee. Sie stellt Wahrheit und Allgemeinheit nur formell dar und degradiert das Individuum materiell auf das belebte Instrument, das den Staatszweck praktisch werden läßt. Was Marx an Hegel im Interesse wahrer Allgemeinheit kritisierte, das realisiert sich in der unmittelbaren und praktischen Setzung unwahrer Allgemeinheit: Identität von Gesellschaft und Individuum. Die Nicht-Identität des Menschen mit sich selbst, wie sie in der Trennung von Bourgeois und Citoyen als Chance zur Emanzipation von Natur sich ausdrückte, findet ihre Auflösung in der Identität von Privatmann und Staatsbürger: Als bornierter und egoistischer Einzelner ist der Mensch zugleich schon die gelungene Verkörperung allgemeiner Vernunft, die nur den verschwindenden Mangel an sich hat, eine bloß instrumentelle, kapitalistische Vernunft zu sein. “Das vereinzelte Individuum, das reine Subjekt der Selbsterhaltung, verkörpert, [ 4 ]
Der Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft ist gedoppelt; er prozessiert auf ökonomischem wie politischem Terrain und hebt in seiner Entwicklung die Vermittlungen von Politik und Ökonomie, von Individuum und Gesellschaft in neuer Unmittelbarkeit auf. Neue Unmittelbarkeit als Identität von kapitalistischer Produktion und bürgerlicher Gesellschaft setzt das Kapital als das “reelle [ 5 ] Wie das Kapital die gesellschaftliche Arbeit als die abstrakte Möglichkeit der Freiheit setzt, so die Republik das Gemeinwesen als die abstrakte Möglichkeit der freien Assoziation. Wie die historischen Bedingungen, unter denen das Kapital emanzipatorischen Gebrauchswert, nicht nur konsumierbare Produkte setzt, historisch vergänglich sind, so auch die, unter denen die bürgerliche Republik den Menschen als einen solchen, nicht als Agenten selbstloser Selbsterhaltung ermöglichen kann.
Vor dem Ende der bürgerlichen Schizophrenie
Wie auf ökonomischer Ebene am Beginn kapitalistischer Vergesellschaftung der Doppelcharakter der Arbeit darin besteht, einerseits die Produktion konkret nützlicher Gebrauchswerte zu sein, deren stoffliche Qualität naturverbunden ist, andererseits Produktion von Waren als der Verkörperung des abstrakten Werts und als die Mittel der Realisierung des Profits, so besteht auf politischer Ebene der Doppelcharakter des Menschen darin, einerseits belebte Natur zu sein, Bourgeois, der die Gesetze der Warennatur als [ 6 ] und andererseits Staatsbürger, Citoyen, dessen privates Handeln dem Gesetz allgemeiner Wohlfahrt genügen soll. Als Staatsbürger und Person ist er das Produkt des Rechtes, das ihn ebenso nach Maßgabe der formellen Gleichheit aller im Recht zum politischen Subjekt der Souveränität erhebt, wie ihn zugleich die Herrschaft des Warentausches nach Maßgabe der materiellen Gleichschaltung aller vor dem Tauschwert zum lebendigen Anhängsel und Subaltern der kapitalistischen Produktion erniedrigt.
Vor dem Übergang des Kapitals von der formellen zur reellen Subsumtion der gesellschaftlichen Produktion unter die endlose Selbstverwertung des Werts kann der Doppelcharakter des Menschen homolog zu dem der Arbeit und der Ware gedacht werden: das Humane ist die eigentliche Substanz der Staatsbürgerlichkeit, wie die praktische Reduktion des Menschen auf den egoistischen Bourgeois nur die pervertierte Form des Humanen darstellt, die es annimmt, um den Menschen aus der Verfallenheit an Natur zu befreien. Die abstrakte Staatsbürgerlichkeit stellt einen Begriff objektiver Möglichkeit von Emanzipation dar, bedeutet sie doch die Befreiung aus jenen Formen naturwüchsiger Gemeinschaft, die nur den ebenso sturen wie stummen Naturzwang in die menschliche Gesellschaft hinein verlängern. Mit der Verwandlung der Familienmitglieder, Leibeigenen und Hörigen in Staatsbürger ist die freie Assoziation der Produzenten als eine historische, durch sozialistische Revolution nur zu nutzende Chance einer anders als nur formellen Freiheit gesetzt. Die Setzung der Warenbesitzer als Rechtspersonen stellt die gegen den konkreten Willen der Individuen erzwungene Humanisierung ihres wechselseitigen Bezuges dar. “Obwohl das Individuum A Bedürfnis fühlt nach der Ware des Individuums B, bemächtigt es sich derselben nicht mit Gewalt, noch vice versa, sondern sie erkennen sich wechselseitig an als Eigentümer, als Personen, deren Willen ihre Waren durchdringt. Danach kommt hier zunächst das juristische Moment der Person [ 7 ] Im rechtlich geregelten Tausch erscheint die Freiheit abstrakt enthalten, denn die Individuen degradieren einander zwar auf die Mittel ihrer Selbsterhaltung, erkennen dadurch jedoch implizit an, daß die eigene Selbsterhaltung nur als die des anderen zugleich möglich ist: “Das heißt, das gemeinschaftliche Interesse, was als Motiv des Gesamtaktes erscheint, ist zwar als fact von beiden Seiten anerkannt, aber als solches ist es nicht Motiv, sondern geht sozusagen nur hinter dem Rücken der in sich selbst reflektierten Sonderinteressen, dem Einzelinteresse im Gegensatz zu [ 8 ] Zwar stellt das allgemeine Interesse nur die “Allgemeinheit der [ 9 ] dar, aber als ein allgemeines ist es zugleich abstrakte Möglichkeit konkreter Aneignung des humanen Interesses.
Der politische Doppelcharakter des Menschen drückt sich in der Schwierigkeit des klassischen bürgerlichen Staatsrechts aus, seine gleichzeitige Existenz als Souverän und Subjekt des Staates einerseits, als subalternes Objekt der Staatsbürokratie andrerseits zu begreifen, ohne auf das Fundament dieses Widerspruchs zu rekurrieren. So weist etwa der führende bürgerlich-demokratische Staatsrechtler des wilhelminischen Deutschland, Georg Jellinek, der Versammlung der Menschen im Staat “eine doppelte Funktion” zu, sofern der Staat die Form der demokratischen Republik annimmt: “Das Volk gehört dem Staate als dem Subjekt der Staatsgewalt an, wir nennen es (…) das Volk in seiner subjektiven Qualität. Sodann aber ist das Volk in andrer Eigenschaft Gegenstand staatlicher Tätigkeit, Volk als Objekt”. Das Volk ist Subjekt und Objekt in unmittelbarer Identität; wie es in seiner Eigenschaft als Souverän aus freiwillig “Koordinierten” besteht, so aus “Subordinierten” unterm Blickwinkel der Staatsgewalt. “Der Staat ist zugleich genossenschaftlicher wie herrschaftlicher Verband”, schreibt [ 10 ] und erklärt sich diese Ambivalenz nach dem Muster zeitlich beschränkter Delegation, aus der praktischen Unmöglichkeit der Verwandlung der Gesamtgesellschaft in ein Parlament in Permanenz. Der Versuch, die Identität auch materiell zu fundieren und politische Herrschaft als Ausdruck freiwilliger Selbstbeherrschung der Souveräne durch sich selber auszulegen, scheitert, und die bürgerliche Staatsrechtslehre vermag das Volk als den Souverän nur in der juristischen Sekunde des Wahlaktes als wirklichen Souverän zu fingieren. Die Souveränität dauert nicht länger als das Einwerfen des Wahlzettels in Anspruch nimmt.
Die Unentschiedenheit des klassischen bürgerlichen Staatsrechts vorm Problem der Republik reflektiert, daß das Recht neben der funktionalen Garantie des freien und gerechten Tausches als der Form, die die kapitalistische Ausbeutung und Mehrwertproduktion notwendig [ 11 ] auch Momente des emanzipierten Gattungswesens enthält. Nur daher kann Marx es zur konkreten Utopie erklären, daß “der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in [ 12 ] um sich die nur abstrakte Freiheit auch konkret anzueignen. Die nur politische Emanzipation, die es allen Menschen, dem Millionär wie dem Bettler, verwehrt, winters in geheizten öffentlichen Bibliotheken zu nächtigen, besitzt – virtuell – einen emanzipativen Aspekt. Das Leiden als eines an der Gesellschaft ist, anders als das unter Natur, aufhebbar: die Vermittlungen sind der potentielle Hebel dieser Aufhebung. Als die “Reduktion des Menschen einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische, unabhängige Individuum, andererseits auf den [ 13 ] demonstriert die Republik den Selbstwiderspruch des Menschen unter der Herrschaft des Kapitals, eine menschliche Substanz zwar zu besitzen, aber nur als gesellschaftliche Möglichkeit, der Konkurrent zu sein, aber nur als seine historisch vergängliche Form.
Die Republik verabsolutiert diesen Widerspruch ins äußerste Extrem. Sie ermöglicht die politische Herrschaft des Kapitals nur unter der Bedingung des allgemeinen Wahlrechts und “zwängt ihre politische Herrschaft in demokratische Bedingungen, die jeden Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Herrschaft selbst in Frage stellen, von den einen verlangt sie, daß sie von der politischen Emanzipation nicht zur sozialen fort-, von den anderen, daß sie [ 14 ] ein Selbstwiderspruch der Republik, der nur drei Lösungen zuläßt: Diktatur einer charismatischen Persönlichkeit als das Resultat der Klassenkämpfe in Frankreich nach 1848 oder der in Deutschland vor 1933 einerseits, Herrschaft der in den Räten der ’Commune‘ von 1871 zur wirklichen Selbstverwaltung radikalisierten Souveränität der Produzenten andrerseits. Als dritte Lösung und perverse Vermittlung von Diktatur und Selbstverwaltung erweist sich der moderne kapitalistische Staat: er bricht mit dem Liberalismus, dessen politisches Wesen in der Verweigerung des Wahlrechts für die eigentumslosen Massen bestand und realisiert das allgemeine Wahlrecht, aber nur, um die durchs allgemeine Wahlrecht gesetzte Emanzipation des Staates von unkalkulierbarer, durch die Willkür konkreter Personen bezeichnete Gewalt als die Anonymisierung der Gewalt neu zu organisieren. Und er bricht zugleich dem Wunsch nach Selbstverwaltung den Stachel, indem er die Anonymität und Subjektlosigkeit von Herrschaft als ihre gänzliche Abwesenheit erscheinen läßt. Das Verschwinden der Herrschaft im modernen kapitalistischen Staat, der doch zugleich zum Zwecke der Souveränität nach außen und innen, für Krieg und Bürgerkrieg, über das Monopol der bewaffneten Gewalt verfügt, ist die Geschichte der Hegemonie, der Wattierung der Gewalt durch die spontane Zustimmung der Subalternen und Ausgebeuteten, an deren logischen Ende die Psychokratie als freiwillige Selbstverwaltung der Ausbeutung durch die Ausgebeuteten als auch soziale Wirklichkeit stehen kann. Der moderne kapitalistische Staat ist, als “integraler Staat” [ 15 ] die Versöhnung von Hegemonie und Gewalt, von spontanem Konsens und imperativischer Anordnung. Er ist dies seinem logischen Begriffe nach: die konkrete Utopie kapitalistischer Herrschaft zielt auf den nur mehr gelegentlichen symbolischen Gebrauch zu pädagogischen Zwecken. Die manifeste Gewalt ersetzt sich durch die Mikrophysik der Macht, die Bündelung von Konsenstechnologie und sanftem Zwang, die den Subalternen noch das Bewußtsein eines Unterschiedes zwischen “denen da oben – wir hier unten” austreiben möchte. Herrschaft wird über der Gesellschaft zerstäubt, delegiert und säuberlich unterteilt. Am Ende löste Herrschaft sich auf in das in Permanenz tagende Parlament von 60 Millionen souveränen und absoluten deutschen Monarchen und die Zerstörung der Duodezfürstentümer durch die französische Revolution wäre mehr als nur umsonst gewesen. Der Liberalismus, dem sich schon stets die privaten Laster wie von selbst zum allgemeinen Nutzen addierten, hätte sich gesellschaftlich bewahrheitet. Es stimmte dann, was sich der Kulturkonservativismus nur erhofft: “Die Gesellschaft wird mehr und mehr zu einem Gedankennetz, zu einer Art Phantasiebild, das wir als gesellschaftliche Konstruktion zu [ 16 ]
Dieser Zustand vollendeter Hegemonie gliche, als die von der Subalternen wirklich geglaubte und als negative und wirklich vorhandene Identität des materiellen Interesses mit seiner politischen Vertretung, einer Karikatur des Kommunismus, zumindest seiner rohen, staatskapitalistischen Erscheinungsform. Wird doch im rohen Kommunismus die Gleichheit aller vor der Arbeit ebenso abstrakt gesetzt wie in der bürgerlichen Republik die Gleichheit aller vor dem Gesetz. “Die Bestimmung des Arbeiters wird nicht aufgehoben, sondern auf alle Menschen ausgedehnt”, und der staatskapitalistische Kommunismus ist so nicht die Aufhebung, sondern die “Verallgemeinerung und Vollendung” des Privateigentums: “Die Gemeinschaft ist nur eine Gemeinschaft der Arbeit und der Gleichheit des Salairs, den das gemeinschaftliche Kapital, die Gemeinschaft als [ 17 ] Die staatskapitalistische Karikatur auf den Kommunismus gleicht dem privatkapitalistischen Original so sehr, daß die Menschen zu Recht die Mühe scheuen, das Original gegen die Karikatur einzutauschen.
Hegemonie verlängerte die juristische Sekunde der fingierten Souveränität der Subalternen zur gesellschaftlichen Ewigkeit und schafft der Fiktion ein materielles Fundament. Wo eine Fiktion zur sozialen Wirklichkeit wird, da kann es anders als okkult gar nicht hergehen. “Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber im Geheimen sich davon auszunehmen bereit ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solchen bösen Gesinnungen hätten”, das erachtete Immanuel Kant als die Hauptleistung jener wundertätigen ’unsichtbaren Hand‘, die “selbst einem Volk von Teufeln” den Effekt der privaten Laster und Egoismen zum [ 18 ] Die Metaphysik des “Als ob” wird hegemonial zur Sozialtechnologie des sozialen Okkultismus umgeschmolzen; der “Spiritualismus des Staates” erhebt die “wirkliche Geistlosigkeit des Staates zum [ 19 ] Die Unterstellung, ein jedes Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft habe (ex post) so gehandelt, “Als ob” sein Handeln aus einem allgemeinen Gesetz (ex ante) bestimmt worden sei, wird zur Realität im gleichen Maße, in dem die gesellschaftliche Synthesis nicht mehr im Nachhinein, d. h. im Austausch der privat erzeugten Produkte auf dem Markt sich herstellt (formelle Subsumtion), sondern bereits in den unmittelbaren Produktionsprozeß [ 20 ] Der Okkultismus des “Als ob” wiederholt nur auf der politischen Ebene, was in der Ökonomie schon geschah: Die Materialisierung eines ganz und gar unsinnlichen, abstrakten und unempirischen sozialen Verhältnisses in einem empirischen, sinnlich erfahrbaren und konkreten Ding, im Geld, einem merkwürdigen [ 21 ] Das politische Verhältnis, das die Subalternen als die wirklichen Souveräne und Subjekte des Staates glaubhaft fingiert, ist dem ökonomischen, das die Produktion der Tauschwerte zur unmittelbar gesellschaftlichen Produktion werden läßt, homolog und ist daher selber nur in spirituell-okkulten Begriffen noch faßbar. Was hier geschieht, ist einerseits so völlig unvernünftig und andrerseits so handgreiflich wirklich, daß der Kopf dies zu Recht nicht fassen mag.
Ein längeres Zitat aus der Marxschen “Kritik des Hegeischen Staatsrechtes” sei gestattet, um die Implikationen dieses Verhältnisses realer Abstraktion, die durch Paraphrase an Schärfe und Klarheit nur verlieren könnten, aufzuzeigen. Marx geht von eben der Frage aus, die Immanuel Kant mit der ’unsichtbaren Hand‘ beantwortete: Wie kann das konkrete Individuum den abstrakten Standpunkt der Staatsbürgerlichkeit erlangen? Nur durch eben jene im Resultat negativen Vergesellschaftung praktisch gewordene atheistische Theologie der unsichtbaren Hand, die im Vergleich mit dem Aberglauben ans Jüngste Gericht den schönen Vorteil hat, ihren Gottesbeweis tagtäglich führen zu können: “Dieser politische Akt ist eine völlige Transsubstantion. In ihm muß sich die bürgerliche Gesellschaft völlig von sich als bürgerliche Gesellschaft, als Privatstand lossagen, eine Partie seines Wesens geltend machen, die mit der wirklichen bürgerlichen Existenz seines Wesens nicht nur keine Gemeinschaft hat, sondern ihr direkt gegenübersteht. Am Einzelnen erscheint hier, was das allgemeine Gesetz ist. Bürgerliche Gesellschaft und Staat sind getrennt. Also ist auch der Staatsbürger und der Bürger, das Mitglied der bürgerliche Gesellschaft getrennt. Er muß also eine wesentliche Diremption mit sich selbst vornehmen (…) Um also als wirklicher Staatsbürger sich zu verhalten (…), muß er aus seiner bürgerlichen Wirksamkeit heraustreten, von ihr abstrahieren, von dieser ganzen Organisation in seine Individualität sich zurückziehen; denn die einzige Existenz, die er für sein Staatsbürgertum findet, ist seine pure, blanke Individualität, denn die Existenz des Staates als Regierung ist ohne ihn fertig und seine Existenz in der bürgerlichen Gesellschaft ist ohne den Staat fertig. Nur im Widerspruch mit diesen einzig vorhandenen Gemeinschaften, nur als Individuum, kann er Staatsbürger sein (…) (Daher) muß seine wirkliche Organisation, das wirkliche bürgerliche Leben, als nichtvorhanden gesetzt werden (…) Die Trennung der bürgerlichen Gesellschaft und des politischen Staates erscheint notwendig als eine Trennung des politischen Bürgers, des Staatsbürgers, von der bürgerlichen Gesellschaft, von seiner eigenen wirklichen, empirischen Wirklichkeit, denn als Staatsidealist ist er ein ganz anderes, von seiner Wirklichkeit verschiedenes, unterschiedenes, entgegengesetztes Wesen (…) Der Bürger muß seinem Stand, die bürgerliche Gesellschaft, den Privatstand, von sich abtun, um zu der politischen Bedeutung und Wirksamkeit zu kommen; denn eben dieser Stand steht [ 22 ]
Damit der Mensch als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft zum Faktor werden kann, der politisch zählt und sich zu Wahlstimmen, zu Mehrheit und Minderheit addieren kann, muß er sein soziales Alltagsleben als nichtig erachten und zum Staatsidealisten werden, indem er von seiner “gemeinschaftlichen Existenz” praktisch abstrahiert. Wie auf ökonomischer Ebene der Doppelcharakter der Arbeit aufgehoben und der Produzent aus dem Co-Subjekt der Produktion, das er in der Manufaktur und den frühen Stadien der Mechanisierung der Produktion noch ist, zu einem lebendigen Anhängsel der Maschinerie – der Objektivierung des Werts in der unmittelbaren Produktion degradiert wird, so auch auf der politischen Ebene: der politische Akt, mittels dessen nur das Individuum den Standpunkt gesellschaftlicher Allgemeinheit erreichen kann und den Marx in objektiver Ermangelung eines vernünftigen Begriffes für ein unvernünftiges Verhältnis mit einem theologischen ’Begriff belegt, ist eine Realabstraktion par excellence. Als die im religiösen Meßopfer sich okkult vollziehende Verwandlung der Substanz von Brot und Wein in Leib und Blut des Herrn Jesu Christ bezeichnet die “Transsubstantion” die durchgeführte Einheit des Alltäglichen mit dem Spirituellen mit dem Unterschied nur, daß das Spirituelle in der politischen Realabstraktion auch Wirklichkeit besitzt. Es zeigt sich hierin, daß alle Kritik bei der Kritik der Theologie nicht nur beginnt, sondern, im Zustand der zur zweiten Natur mutierenden Gesellschaft, dort auch endet.
Die Realabstraktion, die der Staatsbürger an sich selbst als einem Menschen und Mitglied der Gesellschaft vornimmt, weitet sich über den unmittelbaren Akt der demokratischen Wahl hinaus auf das Alltagsleben aus und schießt zurück in den Grund, aus dem ihre Notwendigkeit entstand. Der Bürger bedurfte des Staates als des ideellen Gesamtkapitalisten, weil anders als mittels einer zwischen den einzelkapitalistischen Interessen vermittelnden und also (systemimmanent) neutralen Schiedsrichterinstanz die allgemeinen Reproduktionsbedingungen des Kapitalismus als der Form gesellschaftlicher Produktion nicht herzustellen waren. Er mußte von seinem besonderen Geschäftsinteresse absehen lernen, um sein allgemeines Interesse an der Einhaltung der Geschäftsordnung durchzusetzen; es mußte ihm im eigenen Interesse beigebracht werden, daß der Weg zur Vergoldung der eigenen Nase auch über die Konjunktur des Konkurrenten verläuft. Aus der bloßen Form gesellschaftlicher Produktion wird nach der Eigenlogik der Realabstraktion nun ihr Inhalt, und das Kapital übersetzt sich in das reelle Gemeinwesen, das einen Unterschied zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Interesse nicht mehr zulassen mag. Was im Unterschied zwischen der sozialen und der politischen Herrschaft des Bürgertums – ein Unterschied, der den Bürger den 18. Brumaire 1850 und den 30. Januar 1933 prächtig überleben ließ – angelegt war, das radikalisiert sich in der demokratischen Republik: Der Bürger verliert die Herrschaft im eigenen Haus und wird zum Anachronismus, zum Neandertaler seiner eigenen Ökonomie. Dem Verlust der politischen Herrschaft, die durchs Zensurwahlrecht garantiert war, folgt der Verlust seiner sozialen Herrschaft auf dem Fuße. Das Kapital emanzipiert sich von seinem Eigentümer, organisiert sich als Aktiengesellschaft und degradiert den selbstherrlichen Kapitalisten der Gründerjahre zum müßigen Rentner und für den Gedeih von Zins und Zinseszins überflüssigen Lebemann. Das Bürgertum stirbt den sozialen Tod und verschwindet im gleichen Maße, in dem das Kapital seinen Geburtshelfer für überflüssig [ 23 ] Dem korrespondiert die negative Aufhebung der Arbeiterklasse: Wo der Geburtshelfer überflüssig geworden ist, da herrscht das ewige Leben, und die Totengräber, die sich das Kapital in der Analyse des “Kommunistischen Manifests” in Gestalt des Proletariats noch selber erzeugen sollte, werden selbst zu Toten auf Urlaub, deren gesellschaftliche Überflüssigkeit im Prinzip schon feststeht und die sich einstweilen noch an Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder anderen, nur wenig größeren Zuwendungen in Form von Lohn und Gehalt delektieren dürfen.
Die Atomisierung der Individuen, die die Realabstraktion auf dem politischen Feld hervorbringt und die im Vergleich zur naturwüchsigen Familie und zur dörflichen Gemeinschaft einen ungedeckten Wechsel auf die zukünftige Freiheit bedeutete, endet in der Gesellschaft als einer Gummizelle, in der die Individuen wie die Atome im Reaktor herumgewirbelt werden, heillos miteinander kollidieren und dadurch die zum Betrieb der Zelle nötigen Energie erzeugen. Inmitten der unaufhebbar werdenden Unfreiheit scheint die durchgeführte Freiheit zu herrschen. Das Menschenbild, das die diversen ’humanistischen‘ Therapietechniken den Individuen einbläuen wollen, ist der Reflex der sich anbahnenden völligen Fundierung von Herrschaft in menschlicher Spontaneität. Dem gilt das pseudo-religiöse Credo des Erfinders der Gestalttherapie, Fritz Perls: “Ich tu, was ich tu; und du tust, was du tust. Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben. Und du bist nicht auf dieser Welt, um nach meinen zu leben. Du bist du, und ich bin ich. Und wenn wir uns zufällig finden – wunderbar. Wenn nicht, kann man auch nichts [ 24 ] Freiheit als Zufall, Liebe als blinder Zusammenstoß, Spontaneität als entobjektivierte Zusamenhangslosigkeit – der Selbstwiderspruch, der den Bürger einerseits “ordentlicher [ 25 ] sein ließ, ist aufgehoben und der neue Mensch kann sich als tollwütiger Staatsbürger und ordentliches Raubtier zugleich aufführen, kann sowohl in der Konkurrenz wie auch vor seinem Gewissen bestehen. Er lebt im Jenseits der bürgerlichen Schizophrenie, die darin bestand, was man tun mußte, besser lassen zu sollen.
Der “innere Maschinist” des Arbeiters und seine staatsbürgerliche Verbesserung
Was am Bürger sich vollzieht, das begann und vollendet sich am Arbeiter, an den unmittelbaren Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums. Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals zerstörte zwar Unfreiheit und Hörigkeit, aber nur um den Preis der gleichzeitigen Zerstörung jener relativen Sicherheit und paternalistischen Fürsorge, die den Produzenten als sprechfähigen Arbeitswerkzeugen von Wert immerhin zukam. Das Kapital spedierte sie in die Freiheit, aber nur, um sie als materiell unfreie und von den Produktionsmitteln ihres Lebens getrennte Lohnarbeiter produktiv ausbeuten zu können. Der bürgerliche Selbstwiderspruch vertieft sich im proletarischen noch: wo der Bürger zwischen Altruismus und Egoismus schwankt, die Caritas und den Weltwährungsfond zugleich im Seelchen spürt, und mit der linken Hand sentimental gewährt, was er mit der rechten doppelt und dreifach brutal einstreicht, da hat der Arbeiter nur eine Wahl. Es steht ihm frei, sich zwischen dem kollektiven Egoismus der Gewerkschaften und dem individuellen zu entscheiden, den die Arbeitgeber ihm ans Herz legt.
Der bürgerliche Selbstwiderspruch erscheint, wenn die politische Vergesellschaftung die Form der demokratischen Republik annimmt, als der zwischen materieller Interessiertheit und abstrakt gesetztem allgemeinem Gattungsinteresse. Der proletarische Selbstwiderspruch ist von vorneherein aufs Ökonomische reduziert und die Versubjektivierung jener Widersprüche, die der Kreislauf des Kapitals als Reproduktionsprozeß aus sich heraussetzt. Der Arbeiter verkörpert den Widerspruch zwischen Produktion und Konsumtion, wobei der Akt des Konsums der Produktion als ein notwendiges Übel erscheint: anders als durch wirklichen Konsum der Waren kann sich der in ihnen enthaltene Wert (noch) nicht realisieren. Im Widerspruch zwischen Produzent und Konsument exekutiert das gesellschaftliche Gesamtkapital seinen eigenen Widerspruch am produktiven Arbeiter. Es besteht darin, den Arbeiter, der – einzelbetrieblich gesehen – einen mehrwertschaffenden Unkostenfaktor darstellt, gleichwohl ernähren zu müssen, ihn auszuhalten auch deshalb, um die Realisierung des Mehrwerts in der Konsumtion zu ermöglichen. Am Gegensatz des Arbeiters als unnützem Fresser, dessen einziger wesentlicher Nachteil darin besteht, noch kein Roboter zu sein und nicht 25 Stunden am Tag aus lauter Lebensfreude schaffen zu können einerseits, der Funktion des Arbeiters andrerseits als eines nützlichen Fressers, der sich im Konsum die Arbeitskraft in eigener Regie erhält und dazu seinen Lohn in völlig freier Wahl zwischen Produkten, die allesamt nur Waren sind, ausgeben muß – daran hatte das Kapital im Krisenwettlauf der Unterkonsumtion mit der Überakkumulation seine liebe Not.
Verliefe die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft nach den Interessen der Kapitalisten, dann wäre das Kapital als ein gesellschaftliches Verhältnis längst bankrott. Denn diese Interessen zielen auf die totale Unterordnung des Arbeiters unter die Produktion: Zustände, wie sie noch 1840 in Manchester herrschten, wären an der Tagesordnung. Damals erreichten die Angehörigen der Arbeiterklasse ein Durchschnittsalter von 17 [ 26 ] Das Interesse des Kapitalisten zielt auf produktive Verschrottung des Menschen durch Arbeit und wie das geht, das zeigt ein Blick auf die Ghettos von Singapur, Hongkong oder Sao Paulo. Das Kapital ruiniert die menschliche Arbeitskraft und damit in der Tendenz sich selber.
Die Rettung des Kapitals erkämpften seine formalen Antagonisten, die formell freien Lohnarbeiter, die sich für den kollektiven Egoismus entschieden. Die Gewerkschaften als die “Verkaufskartelle [ 27 ] begannen mit Lohnarbeitern zu handeln, wie andere Kartelle mit Kühlschränken oder Badewannen. Ihr historischer Kampf zwang dem Kapitalismus die Bedingungen seiner eigenen Existenz auf, setzte die Beschränkung der Arbeitszeit als Garantie des Erhalts der Menschen als Arbeiter und Soldaten durch. Die Anerkennung der Dialektik, daß das Kapital als gesellschaftliche Produktionsweise nur durch den systematischen Verstoß gegen die Interessen der konkreten Kapitalisten gerettet werden kann, war nicht Resultat bürgerlich-allgemeiner Vernunft, sondern Ergebnis materiellen Zwanges. Nicht das Parlament, die proletarischen Organisationen waren es, die dem an sich machtlosen kapitalistischen Imperativ: Systemerhalt, zu sozialer Wirklichkeit verhalfen. Das Parlament hatte zu ratifizieren, was es, hätte der Liberalismus recht, aus der kollektiven bürgerlichen Vernunft und nur seinem Gewissen verantwortlich, hätte produzieren müssen. Aber aus sich heraus vermag das Kapital nicht die Allgemeinheit seiner Reproduktionsbedingungen zu setzen; der Wegfall der gewerkschaftlichen Gegenkraft treibt es in den Ruin, aus dem es, – der Faschismus hat es erwiesen – nur die Flucht nach vorne in den prinzipiell endlosen Raubkrieg antreten kann und die Flucht zurück an den Ursprung der ursprünglichen Akkumulation: Verlängerung [ 28 ]
Der Sozialstaat als Erweiterung des bürgerlichen zum modernen kapitalistischen Staat sucht die Kluft dieses Widerspruchs zu überbrücken. In der Krise widersetzt er sich (relativ gesehen) den Forderungen der Kapitalisten, bzw. vollzieht sie mit zeitlicher Verzögerung, um die Rahmenbedingungen der künftigen [ 29 ] Die Anerkennung der Gewerkschaft als Tarifpartner respektiert ihr Monopol an der Ware Arbeitskraft, die Setzung des Arbeitsrechtes drückt die gesamtkapitalistische Funktion des Erhalts der formellen Freiheit dieser Ware aus und die Erweiterung des allgemeinen Wahlrechts auf die besitzlosen Klassen anerkennt das Recht der Arbeiter, über die Bedingungen ihrer Ausbeutung ein wenig verhandelt zu können, auch auf der Ebene des ideellen Gesamtkapitalisten.
Gleichwohl prozessiert der Selbstwiderspruch des Einzelkapitals weiter. Mit jedem Übergang zu prinzipiell neuen Produktionsmethoden stellt sich erneut das Problem, wie der Arbeiter an den Betrieb zu binden ist, wie seine betriebspezifische Qualifikation, die eine Investition ins variable Kapital darstellt, dem Betrieb auf Dauer oder solange wie nötig erhalten werden kann. Es stellt sich das Problem, wie dem Arbeiter beigebracht werden kann, daß er sich selbst als das Humankapital, das er ist, auch pfleglich behandelt. Denn die ökonomische Bestimmung des Proletariats, vom Co-Subjekt der Produktion auf das belebte Anhängsel der objektiv gewordenen Maschinerie heruntergebracht zu werden, stellt sich dem Proletariat als einer Klasse als Schicksal dar, dem formell freien einzelnen Arbeiter aber nicht. Er kann wählen. Und im Angesicht neuer, arbeitsintensiverer Produktionsmethoden entscheidet er regelmäßig [ 30 ] für den blauen Montag, für Wein, Weib, Gesang und die angenehmen Banalitäten des Alltagslebens. Jeder Übergang auf ein neues ökonomisches Niveau, ob von der Manufaktur zur Fabrik, ob vom Handwerk zum Fließband, erfordert eine völlige Umorganisierung der “moralischen Ökonomie” der arbeitenden Klasse. Wie ihr im Übergang zum Fließband die affektive Besetzung von Produkt und Produktion ausgetrieben und protestantischer Puritanismus anstelle des vorherigen Hedonismus (der einer der Armut war) eingeimpft werden muß, so im Übergang vom Fließband zur computerisierten Produktion die affektive Besetzung des Produktionsmittels, die zwanghafte Triebfixierung, nicht vom Gerät zu lassen, bis das Programm funktioniert.
Die Wahlmöglichkeit des Arbeiters ergibt sich aus der Ungleichzeitigkeit der technologischen Innovation. Sie einzuschränken und Betriebstreue herzustellen, ist daher, von Krupp bis Ford, das Problem der avancierten Industrien. Die frühen Versuche bestehen in der Setzung materieller Stimuli, die zugleich, da mit ihrem Entzug wirkungsvoll gedroht werden kann, Zwangsmittel darstellen: so die Werkswohnungen der Krupp, Ford & Co., die schon aussahen wie künftige Arbeitslager und deren Reglement Alkoholismus, Vielweiberei und andere Laster durch die Lust an Basteln, [ 31 ] All dies sind Formen, die Reproduktion der Ware Arbeitskraft in ihrer Freizeit nach den Normen der Produktion zu organisieren. Das Kapital drängt nach der Subsumtion des Arbeiters, nach der faktischen Aufhebung seiner formellen Freiheit.
Damit soll die Qualifikation des einzelnen endgültig zum Betriebseigentum werden. Henry Ford etwa mußte allein 1913 für die Besetzung von 16.000 Arbeitsplätzen 53.000 Einstellungen vornehmen, die Kosten für die Anlernung waren enorm, obwohl diese höchstens eine Woche dauerte. Die Rationalisierung drohte an sich selbst zu scheitern: “Bisherige Erfahrungen gelten bei uns nicht. (Die Ungelernten) lernen ihre Aufgabe innerhalb weniger [ 32 ] beschrieb Ford dies System. Der profitable Vorteil, die Arbeit auf wenige routinisierte Handgriffe zu reduzieren, geriet in Gefahr, vom hinhaltenden proletarischen Widerstand gegen die Zerstörung ihrer moralischen Ökonomie, gegen die Entwertung ihrer Fähigkeiten und damit ihres bisherigen Lebensstiles, selber gegen Null gedrückt zu werden. Da auch materielle Stimuli, bessere Löhne und betriebliche Altersversorgung, nicht den Effekt ergaben, sowohl die Fluktuation zu unterbinden wie auch die Effektivität der Arbeit zu steigern, mußte der direkte Zugriff auf die interne psychische Konstitution des Arbeiters, auf seine Arbeitsmotivation unternommen werden. Das Kapital suchte die Arbeitskraft auf eben die Maschine herunterzubringen, die sie ihrer ökonomischen Funktion nach längst zu sein hat. Dieser Versuch impliziert die Verallgemeinerung der Fabrik auf die Gesamtgesellschaft und damit die Setzung einer kapitaladäquaten Form von Subjektivität. Sie hat dem Begriff zu entsprechen, den sich die Arbeitsphysiologie vom arbeitenden Menschen macht. Die sieht ihn vom Standpunkt der Geschäftsführung als einen mehrachsigen Gelenken und dreidimensional agierenden Greifapparaten ausgestatteten produktiven Apparat: “In seiner Eigenschaft als ein Element in einem Kontrollsystem muß ein Mensch als eine Kette betrachtet werden, die aus den folgenden Teilen besteht: 1) Sensoren, 2) einem Rechensystem, das auf der Grundlage vorangegangener Erfahrungen reagiert, 3) einem Vergrößerungssystem – den Enden der Bewegungsnerven und Muskeln, 4) mechanischen Verbindungen, mit denen die Muskelarbeit äußerlich feststellbare [ 33 ] Der Mensch ist hier reine Naturkraft, von der ein Bild wie in der Anatomie herrscht, mit dem Unterschied nur, daß die Sektion eine bei lebendigem Leibe ist und die sie vorbereitende Dressur mit jedem Arbeitstag von neuem beginnt.
Die Nagelprobe auf dies Kalkül wird am ersten Punkt, den Sensoren, genommen. Der Mensch ist nicht objektiv, nimmt nicht das wahr, was man verlangt, man hat ihm das Hören und Sehen beizubringen, bis es ihm vergeht. Die Vivisektion hat daher mit der Veränderung der Wahrnehmung zu beginnen, bis sie ihren Blickwinkel (“in seiner Eigenschaft als … betrachtet”) in die Totale ausdehnt und sich um einen Unterschied zwischen “Rolle” und “Mensch” nicht mehr zu kümmern braucht. Mit F.W. Taylor beginnt “ein eingehendes Studium der Motive, welche die Arbeiter in ihrem Tun beeinflussen”. Denn obgleich die Menschen auf den ersten Blick einen Kosmos von Unterschieden darstellen, können sie wissenschaftlich auf einfache Exemplare der Gattung Mensch, auf die millionenfachen Duplikate des alten Adam reduziert werden. Eine Reduktion, die erst dann zur Zufriedenheit gelingt, wenn sich der einzelne Arbeiter zum Betrieb verhält wie die einzelne Arbeitsameise zur Königin: treu bis in die Selbstaufopferung. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß die Reduktion “an einem so komplexen Organismus, wie es [ 34 ] Sie ist zugleich eine Realabstraktion, an deren Ende der Arbeiter auch wirklich die Biomaschine ist, die er sein soll: belebtes Material, das keinen Unterschied mehr erkennen kann zwischen seiner objektiven Arbeitssituation. Die Arbeitspsychologie organisiert den Blick ins zu funktionalisierende Subjekt.
Es gilt, den “Thomas-Effekt” zu beherrschen, um auch die Restbestände proletarischer Subjektivität im Arbeitsprozeß dort, wo .er vom Verwertungsprozeß sich noch unterscheiden läßt, auszumerzen und das Kommando der Direktion mit der Kunst behutsamer Konsenstechnologie reibungsfrei und restlos durchzusetzen. Improvisation und informelle Kommunikation der Arbeitenden untereinander: sie gilt es in den Griff zu bekommen. Sie sind die (negativen) Vetorechte der Arbeiter: kein Betrieb könnte produzieren, ohne mit Aussicht auf Erfolg auf ihre Kunst zur Improvisation zu bauen, ein nach Vorschrift durchgeführter Arbeitsdienst käme der Sabotage gleich. Aber andrerseits ist Improvisation eine Funktion genau der informellen Kommunikation abseits der offiziellen Befehlswege, die Leistungszurückhaltung [ 35 ] Leistungszurückhaltung bedeutet implizit, daß der Arbeiter sich vor restloser Verausgabung schützt, um sich den lebenslangen Genuß seiner Arbeitsfähigkeit zu erhalten, sich vor Überarbeit zu drücken, um sein Arbeitsleben, das in der BRD nur ein Drittel der Beschäftigten gesund übersteht, möglichst auszudehnen. Hier liegt eine der sozialen Wurzeln der Gewerkschaftsbewegung und zugleich das tiefste Fundament des Sozialstaats, der noch unterm Keller des Privatkapitals residiert. Der “Thomas-Effekt” bedeutet den Bruch mit dem satten und statischen Objektivismus F. W. Taylors und enthält die Anerkennung dessen, daß die Reduktion mit materieller Brachialgewalt allein nicht zum Zuge kommt und den Arbeiter zwar dem Betrieb annektiert, die Arbeit selbst aber nicht im gewünschten Maße effektiviert. Es besagt, daß auch jene Faktoren der Arbeitssituation verhaltenssteuernd sind, die sich als wissenschaftlich nicht objektivierbar erweisen, und daß Situationen in ihren Folgen real sind, wenn die Menschen sie kollektiv für real erklären. Es geht nun darum, sich arbeitswissenschaftlich in ihre Motivation einzuschleichen und eine Veränderung ihres Handels durch Veränderung nicht der Verhältnisse, sondern ihrer Wahrnehmung zu organisieren. Psychotechnik bietet sich an, wie einer ihrer neueren Propheten, Kurt Lewin, schreibt, als “eins der besten Mittel, die Dimensionen zu verändern, in denen die Wahrnehmung stattfindet. Es ist wahrscheinlich richtig, wenn man sagt: die Handlung eines Menschen [ 36 ]
Die Maschinisierung des Subjekts beginnt mit der Kontrolle der Seelenmaschine und des diese Maschine nach außen repräsentierenden Individuums. “In gewissem Sinne ist es beim Menschen wie bei einer Dampfmaschine, von der ein zusammengesetztes Triebwerk abhängt. Je nach dem Zustande der Heizung kann ihre lebendige Kraft hoch steigen oder tief sinken; aber im normalen Gange kann weder das eine noch das andere plötzlich eintreten; wohl aber kann dadurch, daß man hier ein Ventil willkürlich auf oder zudreht, bald dieser, bald jener Teil der Maschine neu in Gang kommen und dafür ein anderer in Ruhe übergehen. Es ist nur der Unterschied, daß bei unserer organischen Maschine der Maschinist nicht außer–, sondern innerhalb derselben sitzt”, schreibt schon 1860 der Urvater der Psychophysik in Deutschland, [ 37 ] Die moderne Arbeitspsychologie erkennt, daß sich auch der “innere Maschinist” gewerkschaftlich organisiert hat und setzt nicht, wie noch Taylor, beim isolierten einzelnen an, sondern bei der Arbeitsgruppe, beim Team, und empfiehlt Methoden der “Humanisierung der Arbeit”, wie “Job enrichment” oder “Job enlargement”, um die Psychodynamik der Kleingruppe für die Produktion zu nutzen. Aber der Arbeitswissenschaft bedeutet die Tatsache, daß der Mensch weder allein noch vom Brot lebt, nicht, den sozialen Atomismus der bürgerlichen Gesellschaft in Frage zu stellen. Ihr Credo, daß die Menschen “keine isolierten, beziehungslosen Einzelmenschen sind, sondern soziale Wesen, die auch als solche [ 38 ] zielt auf die Fundierung des Atomismus. Ideologie und Praxis der “Gruppe” wird angedreht, um neben der Objektivität der Produktion einen Schein sekundärer Humanisierung zu erzeugen; das Zwangsverhältnis tüncht sich humanitär. Das permanente Gerede vom Menschen betreibt die Entmenschlichung. Die Gemeinschaft, die synthetisch im “Team” erzeugt werden soll, ist keine naturwüchsige, sondern nur die Miniaturausgabe einer Gesellschaft, die zur zweiten Natur mutiert. Der Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft, der dem Bürger nur im quasi-religiösen Akt der “Transsubstantion” (Marx), d. h. nur schizophren lösbar war, löst sich am Arbeiter: in der Vergemeinschaftung der Arbeit erfährt er ein Leben jenseits der Dualität von formeller Freiheit und materieller Unfreiheit. Die Arbeitspsychologie ist das materielle Fundament der kommenden Psychokratie.
Nichts ist dieser angewandten Psychologie wichtiger als die “Kommunikation”, wenig liegt ihr mehr am Herzen als die “Anerkennung des Wertes der Arbeit”. Die soziale Wirklichkeit ihres Ziels, die Arbeit als eine “quasi-gesprächstherapeutische Situation” (Carl Rogers) zu organisieren, wäre freiwillige Selbstverwaltung der Ausbeutung. Die Betriebspsychologie macht die Erkenntnis zur Technologie, “daß die vom Vorgesetzten kommunizierte Wertschätzung und Akzeptierung im Zusammenhang stehen mit Motivation, Zufriedenheit und Arbeitsleistung ihrer Untergebenen sowie dem Ausmaß der Krankmeldungen und Kündigungen”. Die “Philosophie der Zwischenmenschlichkeit”, die heute in den Encountergruppen als Freizeitspaß konsumiert wird, hat ihre historischen Wurzeln in den Problemen des kapitalistischen Umgangs mit der Arbeitskraft. Sie weiß, “daß Leistungssteigerung in Betrieben immer dann eintraten, wenn die Arbeiter eine persönliche, freundliche [ 39 ] Die fingierte Menschenfreundlichkeit hat sich in den Bilanzen niederzuschlagen. Ein freundliches Wort kostet nichts oder nur das Gehalt eines Psychologen – aber was nichts kostet, das erspart Kosten und ist daher alles andre als nichts.
Glück bedeutet dieser Sorte hinterhältiger Menschenfreundlichkeit nur die gelungene Kompensation der in der Arbeit erfahrenen Leiden; deren völliges Verschwinden aus dem subjektiven Bewußtsein wäre die Ekstase dieses Glücks. Die Arbeitspsychologie erfüllt eine grundlegende Reproduktionsbedingung des Systems: Die Abschiebung der Verdrängung objektiver Probleme, die sich das Kapital mit dem Fortgang seiner Akkumulation selber schafft, ins “Subsystem Persönlichkeit”. Das System wird in dem Maße handlungsfähiger, indem es die Menschen in die Zwangsjacke steckt und verniemandet. So schreibt der mittlerweile bei zur “Codierung von Liebe” vorangeschrittene Betriebswirt und Systemtheoretiker Niklas Luhmann: “Vor allem ’innere‘ Tatsachen: Einstellung, Gefühle und Absichten werden (wenn das Spiel gelingt, d. Verf.) mit der geforderten Rolle auf einen Nenner gebracht … und wenn die erlebten Probleme auf diese Weise verständlich interpretiert werden können, festigt sich dadurch unmittelbar die Situations- und Rollenauslegung. Erklärungen, die die Beteiligten ihren Problemen und Konflikten geben, laufen daher nicht ohne Grund auf falsche Verallgemeinerungen hinaus: Sie lenken von den eigentlichen Grundlagen des Übels in der dominierenden formalen Struktur ab und dirigieren die Vorwürfe ins Persönliche und Moralische, wo sie ohne Konsequenzen verhallen. So kann die formale Rolle als konsistent erscheinen, weil [ 40 ] Was ist, das ist! Die Individuen zu “falschen Verallgemeinerungen” zu bewegen, das bedeutet die Verlängerung des “Hier und Jetzt” der Produktion in die soziale Ewigkeit, denn Erfahrung, die einzig richtig zu verallgemeinern verstünde, braucht genau jene Fähigkeit zum Gedächtnis, zur Erinnerung, die ihre Reduktion aufs blanke und nur aktuelle Erlebnis liquidiert. Die Ablenkung ins “Persönliche und Moralische”, die auf den Korridoren jedes Arbeitsamtes ihren Erfolg lautstark feiert, tankt die Kraft zur Umleitung unmittelbar in der Produktion: den Arbeitslosen geschieht im Zweifel am Sinn ihres Lebens und an ihrer Fähigkeit, sich das Leben zu verdienen, nichts, was sie nicht zuvor im Betrieb, in der vom Chef kommunizierten Anerkennung ihrer Arbeit, genießen durften.
Die Psychologisierung der Arbeit stellt den Motor der Psychologisierung einer Gesellschaft dar, die im Begriff ist, den Unterschied zwischen Kapital und Kapitalismus als einen historischen Tatsache, die sie nichts mehr angeht, endgültig zu überwinden. Hier werden die Anforderungen der Produktion ans Subjekt als die Frage an den Arbeiter gestellt, ob denn dieser ihnen aufgrund seiner Veranlagung, seines Temperaments und seiner psychischen Konstitution, die schließlich seine Privatsache darstellten, überhaupt gewachsen sei. Das zunehmende Verlangen nach Therapie für gesunde und normale Durchschnittsbürger erscheint so als das Resultat einer gelingenden Ausweitung der Betriebspsychologie auf das in seiner Freizeit für die Arbeit sich reproduzierende Subjekt. Die Therapien der ’humanistischen Psychologie‘ nach Erich Fromm, Karen Horney, Carl Rogers u. v. a. sind nur zu verstehen als die auch außerbetriebliche Anwendung der Betriebswirtschaftslehre und speziell der Arbeitspsychologie. Niklas Luhmann: “Die zahlreichen Methoden des verständnisvollen, ’psychiatrischen‘ Führungsstils haben zu einem breiten Zugriff auf die Motivationslage des arbeitenden Menschen geführt. In ihnen hat [ 41 ] Es ist dieser psychiatrische Führungsstil, den sich die Menschen in den Encountergruppen freiwillig antun. Der Gegensatz von öffentlichem und privatem Leben schießt zur negativen Einheit zusammen und es ist kaum noch zu unterscheiden “zwischen der erzwungenen Freundlichkeit bei der Arbeit und dem spontanen [ 42 ] Emotionale Wärme und spontane Herzlichkeit, die unter den Zwischenmenschen längst zum Alltag geworden sind, beschreiben so die physiognomisch gelungene Mimikry der Individuen ans Kapital.
Auf der geglaubten Lüge, auf den Menschen käme es im Stande seiner Überflüssigkeit erst recht an, baut ihre Bewahrheitung auf; Rationalisierung und Automatisierung der Produktion setzen den Menschen als notwendiges Übel voraus, zu dem in der Zwischenzeit sich human verhalten werden muß, soll das Kalkül aufgehen. Die Gruppendynamik wiederholt auf betrieblicher Ebene, was auf gesellschaftlicher durch die Gewerkschaften bereits gelang: die Nutzung des kapitalistisch produzierten Elends als Triebkraft einer falschen Vergesellschaftung, einer “Ablenkung”, die im Betrieb ’en detail‘ nur wiederholt wird. Als gesellschaftliches Organisationsideal tritt die “Philosophie der Zwischenmenschlichkeit” folgerichtig als “Philosophie der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung auf. Ihr ging es stets nicht um die Abschaffung der Lohnarbeit, sondern um ihre ’Anerkennung‘ durch die Honoratioren und Direktoren.
“Die Vorstellung, die Gesellschaft ließe sich mit psychotherapeutischen Mitteln verändern, ist klar reformistisch und entspricht auf psychologischem Gebiet der politischen Praxis der [ 43 ] bemerkt Emilio Modena über Horst-Eberhard Richters Buch “Die Gruppe – Hoffnung auf einen neuen Weg, sich selbst und andere zu befreien”. Er übersieht dabei nur zweierlei: daß zum einen die Zuordnung der Psychotherapie zum Reformismus nichts gegen ihre Wirksamkeit beweist und zum zweiten, daß diese Praxis keineswegs erst der heutigen Sozialdemokratie auf den Leib geschneidert ist. Politisch drückt sich das psychotherapeutische Ordnungsideal in jenen Theorien eines pazifizierten “Weißen Kapitalismus” (heute heißen sie die Theorie der “Industriegesellschaft”) aus, die die Sozialdemokratie bereits am Ausgang des Ersten Weltkrieges, aus lauter Ehrfurcht vor den hohen Löhnen, die Ford zahlen mußte, um seine Arbeiter zu halten, übernahm. Kurt Lewin war damals einer der Theoretiker dieser friedlichen Lösung des sozialen Konflikts, die er am Ende des Zweiten Weltkrieges als Psycho-Trainer an amerikanischen Managerschulen praktizieren half. Seine Biographie stellt den sachlogischen Zusammenhang von Taylorismus, Sozialreformismus, Psychotherapie und modernem therapeutischen Okkultismus exemplarisch vor: 1962 war er bei der Gründung der Okkultzentrale von Esalen/Kalifornien mit der ’crème de la crème‘ der [ 44 ] In einer arbeitswissenschaftlichen Schrift von 1920 über die “Sozialisierung des Taylorsystems” empfahl er die “Psychologisierung der Arbeitsmethoden” im Interesse eines [ 45 ] und schloß sich den Auffassungen Taylors an, die Interessen von Kapital und Arbeit seien an sich identisch. Denn wenn es nur gelänge, mit arbeitspsychologischen Mitteln (bei der Berufswahl oder der Eignungsprüfung etwa) die “Entwicklung eines jeden einzelnen [ 46 ] zu beschleunigen, dann wäre allen gedient: dem Kapital, das den Arbeiter besser verwerten könnte, und dem Arbeiter, weil er vom Gewinn eine Kleinigkeit abhaben darf.
Die Anwendung psychotechnischer Methoden, die von der Sozialdemokratie politisch repräsentiert wird, drängt nach der Umarbeitung der Gesellschaft in ein großes verhaltenswissenschaftliches Psycho-Laboratorium, in dem sodann und folgenlos noch “Mehr Menschlichkeit” geübt werden darf. Historisch scheint die sozialdemokratische Verkennung der Funktion moderner Arbeitswissenschaft leicht erklärlich: Von den drei Gründen, die in den USA nach 1940 und ausgelöst durch die Politik des “New Deal” zur Psychologisierung der Ökonomie führten, war nach 1918 in Deutschland nur einer sichtbar: der Versuch, den Arbeitern die gerade gewonnene Position als gleiche Staatsbürger durch die kompensatorische Anwendung psychologischer Techniken zu unterlaufen. Dem konnte die sozialdemokratische Kapitalismustheorie, der noch ein Spekulant großen Formats wie Hugo Stinnes (wenn auch, natürlich, “unbewußt”) an der Konzentration des Kapitals und damit an der Vorbereitung der sozialistischen Planwirtschaft arbeitete, gelassen entgegensehen. Alles würde den lachenden Erben zufallen. Die anderen Gründe hätten die von Kurt Lewin und vielen anderen behauptete prinzipielle Neutralität der Arbeitspsychologie schon eher in Frage gestellt. Das amerikanische “Human Relation Movement” begann mit den Studien Elton Mayos über die Arbeiter der Hawthorne-Werke und ging sogleich auf Managementschulung und Werbepsychologie über. Die Konzerne waren derart gewachsen, daß die notwendige Kontrolle als bürokratische unmöglich wurde; die Kunst der Delegation, der Schaffung von Verantwortlichkeit und Produktenthusiasmus in den unteren Verwaltungsstäben wurde zur Notwendigkeit. Zugleich warf das “Marketing” neue Probleme auf, die durch den Griff der “Geheimen Verführer nach dem Unbewußten in Jedermann” (Vance Packard) lösbar schienen: die Formung des kaufkräftigen Bedürfnisses nach [ 47 ]
Aber das sozialdemokratische Interesse an einer psychologischen Gesellschaft speiste sich überdies aus dem Wunsch, dem Wert der Arbeit zur Anerkennung zu verhelfen, die “Wirtschaftdemokratie” als die politische Form dieser Anerkennung und als Radikalisierung der Staatsbürgerlichkeit hinunter in die Ökonomie [ 48 ] Die Verbesserung des Arbeiters zum Staatsbürger sollte derart seine Befreiung als Arbeiter einleiten. Die SPD als die Partei des arbeitenden Volkes wurde zur Volkspartei, die ihre Aufgabe im politischen System, das praktische Absehen der Arbeiter von ihrer Klassenlage (d. h.: die “Transsubstantion”) zu organisieren, gewissenhaft ins Werk setzte. War der Sozialismus wirklich “nicht Aufhebung, sondern Veredelung des Staates”, wie es der Staatsrechtler Hermann Heller prosaisch ausdrückte, dann “kommt der Arbeiter dem Sozialismus um so näher, je näher er dem [ 49 ] Die Durchstaatlichung aller Lebensbereiche bedeutete dann die Sozialisierung auf dem Marsch, von unten gefordert durch die dem Kapital innewohnende Tendenz nach Vergesellschaftung, von oben im Interesse der Arbeiter ermöglicht durch eine sozialdemokratische Regierungsmacht.
Damit wird die Subsumtion unters Kapital, der der Arbeiter betrieblich ausgesetzt ist, im politischen Raum verdoppelt. Die Politik der Volkspartei arbeitet an der Aufhebung, bzw. Refunktionalisierung der Formen proletarischer Kollektivität für den kapitalistischen Produktionsprozeß und es wird deutlich, daß der isolierte Arbeiter nicht nur der historische Ausgangspunkt der Partei, sondern auch ihr historisches Resultat ist. “Partei, Staat, Kapital reproduzieren auf diese Weise fortwährend die Grundlagen [ 50 ] Aber als Staatsbürger kommt der Arbeiter zu spät, um den bürgerlichen Selbstwiderspruch als emanzipatorische Chance zu erleben. Sein Weg zur Gleichberechtigung trifft sich mit dem Rückzug des Bürgertums vom historischen Versprechen allgemeiner Emanzipation auf halber Strecke in der negativen Gleichheit aller vor den Zwangsgeboten des produktiven Apparates. Die Dialektik der Selbsterhaltung führt den Bürger wie den Arbeiter zur Selbstverwertung. Verstaatsbürgerlichung der Arbeiterklasse, ihre Verwandlung in den Stand der zeitweilig mit produktiven Aufgaben betrauten Staatsbürger einerseits, kapitalistische Aufhebung des Bürgertums als einer anders als kultursoziologisch definierbaren Klasse in der Anonymität des vom personifizierten Kapital befreiten Kapitals der Aktiengesellschaften andrerseits greifen ineinander und entfalten in ihrer Verknüpfung eine ungeahnte Produktivität. Eine soziale Produktivität, die zur Psychokratie als der durchgeführten Hegemonie drängt und das Ideal von Staat und Kapital, eine Politik ohne Politik, mit den freundlichen Zwangswerkzeugen der Sozialtechnologie ins Werk setzt. Die kapitalistische Kulturrevolution erzwingt den sozialen Autismus als den ihr gemäßen subjektiven Habitus. Dann würde die individualanarchistische Utopie Max Stirners auf perverse Weise doch noch wahr: “Nur dann kann der Pauperismus gehoben werden, wenn Ich als Ich Mich verwerte, wenn ich Mir selber Wert gebe und [ 51 ] Mehr als ihr Leben und ihr “ich selbst” besäßen die Menschen dann nicht mehr. Und was im Überfluß vorhanden ist, hat nur Inflationswert und verkauft sich zu Dumpingpreisen.
Anmerkungen
[ 1 ] Jean-Jacques Rousseau, Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, in: ders., Schriften zur Kulturkritik. Die zwei Diskurse von 1750 und 1755, Hamburg 1978, S.265
[ 2 ] Rousseau, A.a.O., S.261. Vgl. Lucio Colletti, Rousseau: Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft, in: ders., Marxismus und Dialektik, Frankfurt/Berlin/Wien 1977, S.78 ff.
[ 3 ] Karl Marx, Kritik des Hegeischen Staatsrechts, in: Marx-Engels-Werke (MEW), Berlin 1956ff, Bd. l, S.249
[ 4 ] Theodor W. Adorno, Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, in ders., Soziologische Schriften l, Frankfurt 1979, S.55
[ 5 ] Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin 1974, S.430. Zum Begriff des reellen Gemeinwesens vgl. auch Wolfgang Pohrt, Theorie des Gebrauchswerts, Frankfurt 1976, S.200 f.
[ 6 ] Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1: Der Produktionsprozeß des Kapitals, Berlin 1973 (MEW 23), S.101
[ 7 ] Marx, Grundrisse, S.155. Andererseits verhüllt das Tauschverhältnis den zugrundeliegenden Produktionsprozeß nicht nur, sondern dient der Reproduktion seiner Voraussetzungen, der beständigen Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. Die Rechtsförmigkeit vermittelt “den betrügenden Schein einer Transaktion, eines Kontrakts zwischen gleichberechtigten und sich gleich frei gegenüberstehenden Warenbesitzern” auch dann, wenn es um Kauf und Verkauf der Ware Arbeitskraft geht: “Dieses einleitende Verhältnis erscheint … selbst als immanentes Moment der in der kapitalistischen Produktion produzierten Herrschaft der gegenständlichen Arbeit über die lebendige” (Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, Frankfurt 1974, S.88).
[ 8 ] Marx, Grundrisse, S.155
[ 9 ] Ebd.
[ 10 ] Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Dritte Auflage unter Verwertung des handschriftlichen Nachlasses durchgesehen und ergänzt von Walter Jellinek, Berlin 1914, S.406 ff.
[ 11 ] Vgl. Burkhard Tuschling, Rechtsform und Produktionsverhältnisse. Zur materialistischen Theorie des Rechtsstaates, Frankfurt 1976
[ 12 ] ) Karl Marx, Zur Judenfrage, in: MEW l, S.370
[ 13 ] Ebd.
[ 14 ] Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, in: MEW 7, S. 43.
[ 15 ] Vgl. Christine Buci-Glucksmann, Gramsci und der Staat, Köln 1981
[ 16 ] Daniel Bell, Die Zukunft der westlichen Welt. Kultur und Technologie im Widerstreit, Frankfurt 1979, S. 181
[ 17 ] Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in: MEW-Ergänzungsband l, Berlin 1973, S.534 f.
[ 18 ] Immanuel Kant, Werke. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1970, Bd. 9, S. 224
[ 19 ] Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, S.249 und 248
[ 20 ] Vgl. Klaus-Dieter Oetzel, Wertabstraktion und Erfahrung, Frankfurt/New York 1976, v.a. S.158ff. und Stefan Breuer, Die Krise der Revolutionstheorie. Negative Vergesellschaftung und Arbeitsmetaphysik bei Herbert Marcuse, v.a. S. 146 ff.
[ 21 ] Marx, Das Kapital, S.105ff. Der Fetischcharakter des Geldes beweist seine Macht z.B. dadurch, daß die Leute in den Wald gehen und sagen, hier wachse Geld.
[ 22 ] Marx, Kritik des Hegeischen Staatsrechts, S.281
[ 23 ] Vgl. Rainer Rilling, Das vergessene Bürgertum, in: Das Argument Nr. 131 (24. Jg. 1982), S.34 ff.
[ 24 ] Zitiert nach Francoise Castel, Robert Castel, Anne Lowell: Psychiatrisierung des Alltags. Produktion und Vermarktung von Psychowaren in den USA, Frankfurt 1982, S.293
[ 25 ] Zitiert nach Richard Sennett, Die Tyrannei der Intimität. Verfall und Ende des Öffentlichen Lebens, Frankfurt 1983, S.337
[ 26 ] E.P. Thompson, The Making of The English Working Class, Harmondsworth 1979, S.365
[ 27 ] Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, Frankfurt 1973, S.480. Vgl. Manfred Faßler, Der Weg zum “roten” Obrigkeitsstaat? Die deutsche Sozialdemokratie zwischen Feudalismus und bürgerlicher Gegenrevolution, Gießen 1977, S.188ff. und Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis, Frankfurt 1967, S.17ff.
[ 28 ] Marx, Das Kapital, Bd. l, S.741ff. und Alfred Sohn-Rethel, Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus, Frankfurt 1973
[ 29 ] Vgl. Wolfgang Müller/Christel Neusüß, Die Sozialstaatsillusion und der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, in: Probleme des Klassenkampfs, Sonderheft l, Juni 1971, S.7-10
[ 30 ] Vgl. Ernst Benz, Das Recht auf Faulheit oder die friedliche Beendigung des Klassenkampfes. Lafargue-Studien, Stuttgart 1974 und E.P. Thompson, Zeit, Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus, in: ders., Plebeische Kultur und moralische Ökonomie, Frankfurt/Berlin/Wien 1980, S.34-65
[ 31 ] Vgl. A. Brandenburg/J. Materna, Zum Aufbruch in die Fabrikgesellschaft: Arbeitersiedlungen in: Archiv für die Geschichte der Arbeit und des Widerstands, H. 1/1980, S.35-50
[ 32 ] Henry Ford, zitiert nach Jakob Walcher, Ford oder Marx. Die praktische Lösung der sozialen Frage. Berlin 1925, S.46
[ 33 ] Henry Braverman, Die Arbeit im Produktionsprozeß, Frankfurt/New York 1977, S.141
[ 34 ] Frederick Winslow Taylor, Die Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung (1919), München 1983, S.128
[ 35 ] Vgl. J.A.C. Brown, Psychologie der industriellen Leistung, Reinbek 1956, Ralf Dahrendorf, Industrie- und Betriebssoziologie, Berlin 1956, S.67f. und E. Lössl, Die betriebliche Personalorganisation und ihre psychologischen Probleme, in: Handbuch der Psychologie, Bd. 9: Betriebspsychologie, Göttingen 1970, S.441-493 und H. Stirn, Die Arbeitsgruppe, in: Ebd., S.494-520
[ 36 ] Kurt Lewin, Die Lösung sozialer Konflikte. Ausgewählte Abhandlungen über Gruppendynamik, Bad Nauheim 1953, S.200f.
[ 37 ] G.Th. Fechner, Elemente der Psychophysik I. Leipzig 1960, zitiert nach Arnold Schmieder, Wege der Sozialtechnologie. Skizzen zu einer Kritik, in: Psychologie und Gesellschaftskritik, 8. Jg. 1984, H.3, S.111
[ 38 ] F. Roethlisberger, Die Hawthorne-Experimente, in: F. Fürstenberger (Hg.), Industriesoziologie I, Neuwied und Berlin 1966, S.111, zitiert nach A. Schmieder, A.a.O., S.117. Vgl. auch Christa Perabo, Humanisierung der Arbeit. Ein Fall sozialdemokratischer Reformpolitik, Gießen 1979
[ 39 ] Frauke Teegen, Gesprächspsychotherapeutische Elemente in quasitherapeutischen Interaktionssituationen, in: Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (Hg.): Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, München 1975, S.212ff.
[ 40 ] Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, Berlin 1964, S. 51 ff..
[ 41 ] Ders., Systembegriff und Zweckrationalität, Frankfurt 1977, S.131ff.
[ 42 ] David Riesman, Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters, Reinbek 1968, S.279
[ 43 ] Emilio Modena, Marxismus, Freudismus, Psychoanalyse, in: Psychoanalyse, 1. Jg. 1980, H.3, S.226
[ 44 ] Robert Castel, Psychiatrisierung des Alltags. Produktion und Vermarktung von Psychowaren in den USA, Frankfurt 1982, S.303
[ 45 ] Kurt Lewin, Die Sozialisierung des Taylorsystems. Eine grundsätzliche Untersuchung zur Arbeits- und Berufspsychologie, (Praktischer Sozialismus Bd. 4, hrsg. von Karl Korsch), Berlin-Fichtenau 1920
[ 46 ] F.W. Taylor, A.a.O., S.7. Zum “weißen Kapitalismus” vgl. auch Peter Hinrichs, Um die Seele des Arbeiters. Industrie- und Betriebssoziologie in Deutschland, Köln 1981, S.188ff. und Angelika Ebbinghaus, Arbeiter und Arbeitswissenschaft. Zur Entstehung der “wissenschaftlichen Betriebsführung”, Opladen 1984
[ 47 ] Vgl. im einzelnen Ted Bartell, The human relations ideology: an analysis of the social origins of a belief System, in: Human Relations, Bd. 29/1976, S.737-749
[ 48 ] Vgl. Manfred Faßler, A.a.O.
[ 49 ] Hermann Heller, Sozialismus und Nation, Berlin 1925, S.68
[ 50 ] Emilio Modugno, Arbeiterautonomie und Partei. Das Proletariat zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft, in: C. Pozzoli (Hg.), Jahrbuch Arbeiterbewegung 3: Die Linke in der Sozialdemokratie, Frankfurt 1975, S. 308. Vgl. Johannes Agnoli, Wahlkampf und sozialer Konflikt, in: Wolf-Dieter Narr (Hg.), Auf dem Weg zum Einparteienstaat, Opladen 1977, S.213-241
[ 51 ] Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum. Hrsg. von Ahlrich Meyer, Stuttgart 1972, S.282
http://www.ca-ira.net/verlag/leseproben/isf-diktatur.freundlichkeit_lp-isf-einleitung.html
Psychokratie – eine neue Nomenklatura in Deutschland
Es gibt zweierlei Ethik, die Ethik der Moral und die Ethik der Verantwortung.
Die Ethik der Moral begnügt sich mit dem Alarmismus der permanenten Gefahr des nahenden Weltuntergangs und ruft zur immer stärkeren Finanzierung der Wanderprediger auf, die heute als Psychotherapeuten durch die Medienlandschaft ziehen.
Die Ethik der Verantwortung überlegt die realen Möglichkeiten der psychotherapeutischen Hilfe, auch die Grenzen dessen, was der Behandler und der Patient in einer Psychotherapie leisten und erreichen können.
In regelmäßigen Zeitabständen schlagen Vertreter der psychokratischen Nomenklatura Alarmglocken, daß das Heil der Menschheit gefährlich bedroht sei und daß Tätigkeitsfelder der Psychotherapeuten ausgeweitet werden müssen, damit sie die Leidenden dieser Welt durch ihren Ruach (Atem Gottes) von der Pein des Daseins befreien können. „Traumatisierung“ heißt die Erbsünde heute, die überall lauert, und die ein Psychotherapeut heilen könne, alleine durch seinen guten Willen, denn von Indikation, Methode, Wirksamkeit wird unter Psychotherapeuten gar nicht mehr diskutiert. „Jedem alles und zwar sofort!“ – heißt die Devise, und immer mehr Psychotherapeuten dafür immer mehr vom Mammon. Denn nur wenn es ums Geld geht, wird Kommunikation unter Psychotherapeuten lebhaft. Wenn Deutsche von Moral reden, dann geht es ihnen ums Geld. Wenn jeder jeden wird heiraten können, bald auch Individuen sich selbst, wenn sie sich nur stark genug selbst lieben, oder ihr geliebtes Haustier, mit dem schon manche heute Sex treiben, dann kann ein Psychotherapeut jeden psychotherapieren, auch wenn der Patient sich mit dem Psychotherapeuten nicht verbal verständigen kann, keinerlei Bildung hat, ein Analphabet ist und von Reflektion und Meinungsaustausch noch nie gehört hat. Everything goes! Halleluja! Die Psychotherapie in Deutschland ist zu einer religiösen Sekte geworden und eine ihrer Propheten ist Petra Bühring, die Redakteurin des Deutschen Ärzteblattes. Zuletzt hat sie zwei Apostelbriefe veröffentlicht, „Psychotherapeutische Versorgung: Mehr Flexibilität für alle“ in PP 14, Ausgabe Juni 2015, Seite 241 und „Gesundheitsversorgung von Migranten: Asylbewerber haben Anspruch auf Psychotherapie“ in PP 14, Ausgabe Juni 2015, Seite 246.
Dabei zeigt die TK-Studie, daß immer mehr Menschen mit der Diagnose Depression krankgeschrieben werden. Von 2000 bis 2013 nahmen die Fehlzeiten in Unternehmen aufgrund von Depressionen um fast 70 Prozent (sic! ) zu. Aber das reicht den Psychotherapeuten immer noch nicht, es müssen noch Flüchtlinge, Bundeswehrsoldaten, diese und solche und jene Gruppen in die Behandlungszuständigkeit der Psychotherapeuten verschleppt werden, immer mehr und immer mehr – und das Geld der Krankenkassen dafür natürlich auch, denn wo kämen wir hin, wenn jemand seine Behandlung, mindestens zum Teil, selbst bezahlen müßte? Nein, im Raubtiersozialismus muß der Staat alles zahlen, nix Selbstverantwortung!
Dem gegenüber möchte ich hier erinnern, daß eine Psychotherapie nur eine solche ist, wenn der Psychotherapeut erklären kann, was er und sein Patient in einer Psychotherapie denn konkret machen, wozu und mit welchen Mitteln, und wie lange es voraussichtlich dauern und wieviel das Ganze kosten wird? Diese einfache Frage geht aber in dem kosmischen Überschwang der guten Absicht unter. Gut gemeint ist aber schlecht gemacht. Mit den Mitteln der ambulanten psychodynamischen Psychotherapie (TfP, PA) sollen unbewußte neurotische Konflikte und ihre krankhaften Folgen geklärt und aufgehoben werden. „Trauma“ ist einfach ein schweres Erlebnis, es fängt also mit dem Geburtstrauma an, so daß die ganze Menschheit nach dem Prinzip der „Traumabehandlung“ behandelt werden müßte, wenn es nach Frau Bühring und ihresgleichen ginge. Mit dem Trick des „Traumas“, wird die Ursache des neurotischen Leidens aus dem geistigen Inneren des Individuums in die äußere Welt verschoben, der Mensch ist im Konzept des Traumas lediglich wie eine Billiardkugel, die von Aussen angestoßen wird, und hat keine Verantwortung mehr für sein Leiden, er ist einfach nur noch ein Opfer und Bührings sind seine himmlischen Retter. Nix Psychotherapie, nur noch eine Sekte mit Heilungsritualen, mit Kammern als Betroffenheits- und Empörungskanzeln und den Krankenkassen, also wir alle als Solidargemeinschaft, die diese psychokratischen Wanderprediger bezahlen sollen. Ich bin Psychoschmalzvertretern nicht solidarisch.
Helmut Remschnidt schrieb in „Psycho-Boom: Alle entdecken die Seele“ im Deutschen Ärzteblatt 2013; 110(13): A-604 / B-537 / C-537: „Was wir brauchen, ist wieder die Zusammenführung erprobter Therapiemaßnahmen und die Ausgliederung jener, für die es keinerlei Wirksamkeitsnachweise gibt. Was wir brauchen, ist eine ärztliche Ausbildung, die notwendiges Spezialwissen und die Verpflichtung zur Übersicht zu vereinbaren weiß.“
Petra Bühring fordert die Ausweitung der Psychotherapie auf Gebiete außerhalb der Richtlinienpsychotherapie, wohlwissend daß dann eine solche Behandlungsfreiheit grenzenlos wäre. Gottseidank setzen (aber wie lange noch?) Psychotherapierichtlinien und die damit verpflichteten Kontrolleure (sog. Gutachter) dem realitätsfernen megalomanen Anspruch der Psychotherapeuten Grenzen, gegen welche diese immerwieder anrennen.
Zur Erinnerung:
„Schicksalhafte Ereignisse, biographische Schwellensituationen, Fehlverhalten des sozialen Umfelds des Patienten, frühkindliche Traumatisierungen, Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz, Belastungen durch Organminderwertigkeiten usw. – solche Faktoren im weiten Bedingungsfeld der Biographie eines Patienten erbringen allein durch ihr Vorhandensein nicht schon den Nachweis der psychischen Ätiologie einer neurotischen Störung, deren Behandlung damit ausreichend begründet wäre.“ (Siehe Faber/Haarstrick Kommentar Psychotherapie-Richtlinien 9., aktualisierte und ergänzte Auflage, S.17)
„Die vorwiegend strukturell geprägten Persönlichkeitsstörungen, ohne konflikthafte neurotische Aktualproblematik, gehören nicht zum Indikationsbereich der Psychotherapie, weil sie nicht als „seelische Krankheit“ gelten können. Wohl aber können vorwiegend strukturelle Störungen zum Indikationsbereich der psychosomatischen Grundversorgung und vor allem der Psychiatrie gehören und dort in der vertragsärztlichen Versorgung einer verbalen Intervention zugänglich sein.“ (R: C § 21, besonders § 21a 1). (Siehe Faber/Haarstrick Kommentar Psychotherapie-Richtlinien 9., aktualisierte und ergänzte Auflage, S.20)
Gerd Rudolf weist in Forum der Psychoanalyse 2013/3 darauf hin, „dass nicht jedes aktuelle Lebensunglück und gar jede biografische Belastung zwangsläufig eine Traumatisierung bedeutet, dass ferner nicht jede Opferselbstzuschreibung gleichbedeutend ist mit einer posttraumatischen Störung und dass vor allem ein unkritisches therapeutisches Eingehen darauf eher das Risiko einer therapeutischen Schädigung als die Chance eines therapeutischen Nutzens beinhaltet. Wenn mittlerweile in einem erheblichen Teil der tiefenpsychologischen Anträge – und der verhaltenstherapeutischen Anträge ebenso – die genannten Probleme auftauchen, dann liegen die bedenklichen Folgen nicht in den „Nöten der Gutachter“, sondern in der Gefährdung von inadäquat behandelten Patienten; ein Thema, vor dem man nicht die Augen verschließen sollte, wenn man an der Qualität des psychotherapeutischen Versorgungssystems interessiert ist.“
Der psychotherapeutischen Tätigkeit würde es gut tun, wenn Psychotherapeuten mehr sachlich und konkret über die realen Möglichkeiten und Notwendigkeiten ihres Berufes diskutieren würden, anstatt daß sie eigene tatsächliche oder angebliche Kompetenz universal als das einzig denkbar heilende für jede Not marktschreierisch propagieren und dafür immer mehr staatliche Gelder fordern.
am Sonntag, 14. Juni 2015
unredlich
Warum sollen aber die Psychotherapeuten, die nicht zu einer „zwei.Minuten-Abfertigung“ ausweichen können, die Misere alleine ausbaden?
Die Sprechzimmer der somatischen Medizin quellen über von Menschen, denen nichts fehlt außer Lust auf Arbeit oder ein Gesprächspartner zuhause, oder denen wir Ärzte immer mehr normale Gesundheitszustände als krankhaft verkaufen sollen, weil gerade wieder ein neuer Wirkstoff erfunden wurde. Gerade kommt mit der „female sexual dysfunction“ die nächste für ein Arzneimittel erfundene Krankheit auf uns zu. Genauso, wie der Somatiker seine „Verdünnerscheine“ hat, gibt es auch beim Psychotherapeuten Fälle, die „leicht“ und mit wenig Aufwand behandelt werden können, aber dennoch eine ganze Stunde in Anspruch nehmen… seien sie den Psychotherapeuten doch gegönnt, auch somatische Mediziner sind froh, wenn nicht jeder Ratsuchende wirklich schwer krank ist.
Remember: Do X! Don´t do Y!
Protect innocent, respect life, defend art, preserve creativity!
What´s Left? Antisemitism!
http://www.jsbielicki.com/jsb-79.htm
DJ Psycho Diver Sant – too small to fail
Tonttu Korvatunturilta Kuunsilta JSB
Tip tap tip tap tipetipe tip tap heija!
http://www.psychosputnik.com
http://www.saatchionline.com/jsbielicki
https://psychosputnik.wordpress.com/
They want 1984, we want 1776
They are on the run, we are on the march!
Dummheit ist, wenn jemand nicht weiß, was er wissen könnte.
Dummheit äußert sich heute als empörter Moralismus.
Werte ohne Einfühlungsvermögen sind nichts wert.
Manche Menschen fühlen physischen Schmerz, wenn sie ihre gewohnten Vorstellungen zugunsten der Realität korrigieren sollen, sie wenden ihre gesamte Intelligenz mit Unterstützung ihrer Agressivität auf, um die Realität nicht zu erkennen und ihr Selbstbild unverändert beizubehalten.
Immer mehr fühlen, immer weniger denken – Der Mensch unterscheidet sich vom Tier nicht durch Gefühle, denn Säugetiere haben die gleichen Gefühle, wie der Mensch: Trauer, Angst, Wut, Liebe, sondern durch sein Denken. Wenn er denkt, falls er denkt.
Political correctness ist, wenn man aus Feigheit lügt, um Dumme nicht zu verärgern, die die Wahrheit nicht hören wollen.
“Im Streit um moralische Probleme, ist der Relativismus die erste Zuflucht der Schurken.“ Roger Scruton
Antisemitismus ist, wenn man Juden, Israel übelnimmt, was man anderen nicht übelnimmt.
Der Nicht-Antisemit ist ein Antisemit, der nach der derzeitigen deutschen Rechtsprechung, Israel, Juden diffamiert, diskriminiert, delegitimiert, jedoch nicht expressis verbis das Ziel der dritten Reichs, den Holocaust, die Judenvernichtung, befürwortet.
Aus Deutschland erreicht mich „tiefe Sorge um den Friedensprozess“. Vorsicht: Wo ist es im Nahen und Mittleren Osten derzeit so friedlich und vergleichsweise gewaltarm wie in Israel? Wo leben Araber derzeit sicherer als in Israel? Wo haben sie besseren Zugang zu Bildung, Arbeit, Konsum und medizinischer Versorgung? – Götz Aly
Islam ist weniger eine Religion und mehr eine totalitäre Gesellschaftsordnung, eine Ideologie, die absoluten Gehorsam verlangt und keinen Widerspruch, keinerlei Kritik duldet und das Denken und Erkenntnis verbietet. Der wahre Islam ist ganz anders, wer ihn findet wird eine hohe Belohnung erhalten.
Wahnsinn bedeute, immer wieder das gleiche zu tun, aber dabei stets ein anderes Resultat zu erwarten.
Gutmenschen sind Menschen, die gut erscheinen wollen, die gewissenlos das Gewissen anderer Menschen zu eigenen Zwecken mit Hilfe selbst inszenierter Empörungen instrumentalisieren.
Irritationen verhelfen zu weiteren Erkenntnissen, Selbstzufriedenheit führt zur Verblödung,
Wenn ein Affe denkt, „ich bin ein Affe“, dann ist es bereits ein Mensch.
Ein Mensch mit Wurzeln soll zur Pediküre gehen.
Wenn jemand etwas zu sagen hat, der kann es immer sehr einfach sagen. Wenn jemand nichts zu sagen hat, der sagt es dann sehr kompliziert.
Sucht ist, wenn jemand etwas macht, was er machen will und sucht jemand, der es macht, daß er es nicht macht und es nicht machen will.
Sollen die Klugen immer nachgeben, dann wird die Welt von Dummen regiert. Zu viel „Klugheit“ macht dumm.
Wenn man nur das Schlechte bekämpft, um das Leben zu schützen, bringt man gar nichts Gutes hervor und ein solches Leben ist dann nicht mehr lebenswert und braucht nicht beschützt zu werden, denn es ist dann durch ein solches totales Beschützen sowieso schon tot. Man kann so viel Geld für Versicherungen ausgeben, daß man gar nichts mehr zum Versichern hat. Mit Sicherheit ist es eben so.
Zufriedene Sklaven sind die schlimmsten Feinde der Freiheit.
Kreativität ist eine Intelligenz, die Spaß hat.
Wen die Arbeit krank macht, der soll kündigen!
Wenn Deutsche über Moral reden, meinen sie das Geld.
Ein Mensch ohne Erkenntnis ist dann lediglich ein ängstlicher, aggressiver, unglücklicher Affe.
Denken ist immer grenzüberschreitend.
Der Mob, der sich das Volk nennt, diskutiert nicht, sondern diffamiert.
Legal ist nicht immer legitim.
Wer nicht verzichten kann, lebt unglücklich.
Sogenannte Sozial-, Kultur-, Geisteswissenschaften, Soziologie, Psychologie, Psychotherapie, Psychoanalyse, sind keine Wissenschaften mehr, sondern immanent religiöse Kultpropheten, organisiert wie Sekten. Es sind Sozio-, Pädago- und Psychokratien, die Erkenntnis nicht fördern, sondern verhindern.
Ohne eine starke Opposition atrophiert jede scheinbare Demokratie zur Tyrannei, und ebenso eine Wissenschaft, zur Gesinnung einer Sekte.
Man kann alles nur aus gewisser Distanz erkennen, wer sich ereifert, empört, wer mit seiner Nase an etwas klebt, der hat die Perspektive verloren, der erkennt nichts mehr, der hat nur noch seine Phantasie von der Welt im Kopf. So entsteht Paranoia, die sich Religion, und Religion als Politik, sogar als Wissenschaft nennt.
Islamisten sind eine Gefahr, deswegen werden sie als solche nicht gesehen. Juden sind keine Gefahr, deswegen werden sie als solche gesehen. So funktioniert die Wahrnehmung von Feiglingen.
Humorlose Menschen könner nur fürchten oder hassen und werden Mönche oder Terroristen.
Menschen sind nicht gleich, jeder einzelne Mensch ist ein Unikat.
Erkenntnis gilt für alle, auch für Muslime, Albaner, Frauen und Homosexuelle.
Islam gehört zu Deutschland, Judentum gehört zu Israel.
Der Konsensterror (Totalitarismus) ist in Deutschland allgegenwärtig.
Es wird nicht mehr diskutiert, sondern nur noch diffamiert.
Es ist eine Kultur des Mobs. Wie es bereits gewesen ist.
Harmonie ist nur, wenn man nicht kommuniziert.
Man soll niemals mit jemand ins Bett gehen, der mehr Probleme hat, als man selbst.
>>Evelyn Waugh, sicherlich der witzigste Erzähler des vergangenen Jahrhunderts, im Zweiten Weltkrieg, herauskommend aus einem Bunker während einer deutschen Bombardierung Jugoslawiens, blickte zum Himmel, von dem es feindliche Bomben regnete und bemerkte: “Wie alles Deutsche, stark übertrieben.“<< Joseph Epstein
Man muß Mut haben, um witzig zu sein.
Dumm und blöd geht meistens zusammen.
Charlie Hebdo: solche Morde an Juden sind euch egal, mal sehen wie”angemessen” ihr reagiert, wenn (wenn, nicht falls) eure Städte von Islamisten mit Kasam-Raketen beschossen werden.
Christopher Hitchens großartig: „In einer freien Gesellschaft hat niemand das Recht, nicht beleidigt zu werden.“
Je mehr sich jemand narzisstisch aufbläht, desto mehr fühlt er sich beleidigt und provoziert.
“Das Problem mit der Welt ist, daß die Dummen felsenfest überzeugt sind und die Klugen voller Zweifel.” – Bertrand Russel
Das Problem mit den Islamisten in Europa soll man genauso lösen, wie es Europa für den Nahen Osten verlangt: jeweils eine Zweistaatenlösung, die Hälfte für Muslime, die andere Hälfte für Nicht-Muslime, mit einer gemeinsamen Hauptstadt.
Was darf Satire? Alles! Nur nicht vom Dummkopf verstanden werden, weil es dann keine Satire war.
Islamimus ist Islam, der Gewalt predigt.
Islam ist eine Religion der Liebe,und wer es anzweifelt, ist tot.
Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Der Islam ist die friedliche Religion der Liebe – George Orwell 2015
Islam ist verantwortlich für gar nichts, Juden sind schuld an allem.
Islamisten sind Satanisten. Islamismus ist eine Religion von Idioten.
Leute fühlen sich immer furchtbar beleidigt, wenn man ihre Lügen nicht glaubt.
Jeder ist selbst verantwortlich für seine Gefühle.
Die Psychoanalyse geht niemanden außer den Psychoanalytiker und seinen Patienten etwas an, und alle anderen sollen sich verpissen.
“Zeit ist das Echo einer Axt
im Wald. “
– Philip Larkin, Gesammelte Gedichte
Wenn jemand wie Islamisten sein Ego endlos aufbläht, dann verletzt er seine eigenen Gefühle schon morgens beim Scheißen.
„Die sieben Todsünden der modernen Gesellschaft: Reichtum ohne Arbeit Genuß ohne Gewissen Wissen ohne Charakter Geschäft ohne Moral Wissenschaft ohne Menschlichkeit Religion ohne Opfer Politik ohne Prinzipien.“
―Mahatma Gandhi
„Wo man nur die Wahl hat zwischen Feigheit und Gewalt, würde ich zur Gewalt raten.“
―Mahatma Gandhi
Warum zeigt sich Allah nicht? Weil er mit solchen Arschlöchern nichts zu tun haben will.
„Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‚Ich bin der Faschismus’. Nein, er wird sagen: ‚Ich bin der Antifaschismus’.” – Ignazio Silone
Politische Korrektheit verlangt eine Sprache für ein Poesiealbum.
Psychoanalyse ist frivol, oder es ist keine Psychoanalyse.
Bunte Vielfalt, früher: Scheiße
Was der Mensch nicht mehr verändern, nicht mehr reformieren kann, ist nicht mehr lebendig, sondern sehr tot. Was tot ist, das soll man, das muß man begraben: Religion, Ehe, Romantizismus, etc.
Romantik ist scheiße.
Die Realität ist immer stärker als Illusionen.
Ein Wahn zeichnet sich durch zunehmenden Realitätsverlust, und das kann man den heute Regierenden in Deutschland und deren Massenmedien attestieren.
Realitätsverlust beschreibt den geistigen Zustand einer Person, welche nicht (mehr) in der Lage ist, die Situation, in der sie sich befindet, zu begreifen. Ihr werdet also von Wahnsinnigen regiert und durch deren Massenmedien manipuliert.
Der Totalitarismus kann nur besiegt werden kann, wenn man den Mut hat, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen, so wie sie sind. Politischen Korrektheit verhindert es, fördert den Totalitarismus und ist politische Feigheit und politische Lüge.
Die Auslöschung: Islam ist wie die Sonne, wer ihm zu nahe kommt, der verbrennt darin selbst und fackelt den Rest der Welt mit ab.
Islam will keine Unterwerfung! Islam will Sieg, Vernichtung und Auslöschung.
Die Welt wurde nicht nur für dich alleine erschaffen.
Zeit braucht Zeit.
Was hat Gott mit uns vor, wenn er dem Teufel immer mehr Territorien freiräumt?
Es ist nicht die größte Angst, wenn man in einen Abgrund schaut, sondern zu merken, daß der Abgrund zurückschaut.
Ich ist anders.
Muslima mit Kopftuch nerven weniger, als deutsche Mütter mit ihren Kinderwagen.
Prothesen-Menschen – sehen aus wie Frau und Mann, sind aber keine.
Global Governance – der politische Reparaturbetrieb, fängt an zu reparieren, bevor etwas entstanden ist.
Das extrem gesteigerte, angeblich kritische, tatsächlich dämonisierende, Interesse der Deutschen an Israel und Juden ist pervers.
Helden von heute wissen nichts, können nichts und wollen nichts. Sie schauen einfach wie Helden aus, das ist alles.
Mag sein, daß früher Väter ihre Kinder gefressen haben. Heute fressen die Mütter alles, Väter, Kinder und den Rest. Alles Mutti, irgendwie!
Deutschland gestern: der Wille zur Macht.
Deutschland heute: der Wille zur Verblendung.
Deutschland morgen: 德國
Deutsche Psychoanalyse? Großartig, wie deutscher Charme, deutscher Humor und deutscher Esprit.
Der Widerstand fängt mit einer eigenen, anderen Sprache als die der Diktatur.
Smart phones for stupid people.
Ein Linker kann, muß aber nicht dumm sein.
Wenn man ganzen Staaten nicht übel nimmt, wenn sie mit Millionen Opfern Selbstmord begehen, warum dann einem Co-Piloten mit 149 Toten?
Nur die Reinheit der Mittel heiligt den Zweck.
Ein extremer Narzißt ist ein potentieller Terrorist, und jeder Terrorist ist ein extremer Narzißt.
Islamisierung bedeutet Verblödung.
…der hiesige Autoritarismus (ist) einer ohne Autorität und der hiesige Konventionalismus einer ohne Konventionen. Schon bei den Nazis war nicht das Wort des Führers Befehl, sondern sein Wille, den der kongeniale Volksgenosse erahnte. Nie hätte der Nationalsozialismus funktioniert, hätte den Deutschen jede ihrer Missetaten bei Strafandrohung befohlen werden müssen. Anders, als es das Wort vom „Befehlsnotstand“, von der „Gleichschaltung“ oder vom „Führer“ selber glauben machen will, herrschte das NS-System durch Gehorsam ohne Befehl. (W. Pohrt, Der Weg zur inneren Einheit)
Der faschistische Sozialpakt existiert im bundesdeutschen Postfaschismus weiter als eine im Resultat aufgehobene Voraussetzung, die unmittelbar keine Spur ihrer gewaltförmigen Durchsetzung mehr an sich trägt: umso besser kann diese Tatsache verleugnet und der Nationalsozialismus als das Verbrechen einiger Irrer, als „Unrechtsstaat“, als „das Schlimmste, das Menschen einander je angetan haben“ exorziert werden. Diese Lebenslüge der BRD ist das Fundament aller demokratischen „Vergangenheitsbewältigung“, jenes kollektiven Beschweigens des Nationalsozialismus, das durchaus auch die Form enervierender Redseligkeit annehmen kann. Weil das postfaschistische Deutschland in institutioneller wie personeller Hinsicht in Kontinuität zu seinem Vorgänger steht, muß ausnahmslos jeder Versuch einer Vergangenheitsbewältigung innerhalb des sich weiterschleppenden Systems zur symbolischen Distanzierung, zum substanzlosen Gestus geraten. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Deutschen einen schier unerschöpflichen Vorrat an größeren und kleineren Entlastungslügen angelegt, aus dem sie sich je nach Gelegenheit und Bedarf bedienen. Danach war das nationalsozialistische System wahlweise das Werk von Hitler höchstpersönlich, einer kleinen Verbrecherclique und ein paar Helfershelfern oder des Monopolkapitals und seiner Schergen. Otto Normalvergaser jedenfalls hat „von alledem nichts gewußt“, war „im Grunde auch dagegen“ oder „konnte gar nicht anders handeln“, weil „Befehlsnotstand“ herrschte und man im Falle des Zuwiderhandelns sofort „ins KZ gekommen“ wäre. “ (…) „Heute haben die Verbreitung des Gerüchts und die Verbreitung der Neidbeißerei neue, technische Möglichkeiten. Sie können sich über das Internet und diverse Subnetzwerke und Blogs rasend verbreiten und auch auf die Politik einen Druck erzeugen, sich ihnen zu beugen. Die gesellschaftliche Mobilmachung wirkt so wieder auf die Politik zurück. Sie muss sich den entsprechenden Stimmungen beugen, weil sonst die Wiederwahl gefährdet würde. Die Devise »Ich bin ihr Führer, also muss ich ihnen folgen«, bleibt auch im zerfallenen Postnazismus das prinzipienlose Grundprinzip von Herrschaft.“ (…) Spezialisierung und Diversifikation sind die zeitgemäße Erscheinungsform von Vermassung und Uniformität. (…) 1 x 1 materialistischer Kritik: es muss darum gehen, Erscheinungen in eine Konstellation zu bringen, in der sie lesbar werden. (…) Je antirassistischer und weltoffener sich die Deutschen aufführen, desto mehr ähneln sie wieder einer gegen ihre Todfeinde verschworenen Horde, die nicht mehr auf Exklusivität pocht, sondern die Anforderungen zum Mitmachen wieder flexibilisiert hat und sich ihr Jagdrevier mit anderen teilt, sofern sie sich bewähren. Und weil gerade die Entfernung vom Nazismus die Nähe zu ihm verbürgt, waren und sind das diejenigen, die in Personensache am wenigstens mit Nazifaschistischem in Verbindung zu bringen sind, die Linksradikalen, die Linksliberalen, die Linken, die Antifaschisten, die entschiedensten Schrittmacher dafür, dass der anfangs noch gar nicht wirklich übergreifende postnazistische Fundamentalkonsens tatsächlich totalisiert und auf die Höhe der Zeit gebracht werden konnte. Die Nazis und die Rechten hingegen waren für diesen Vorgang nur von unterordnetem Belang. Sie standen immer schon für eine in ihrer konkreten Ausprägung gestrige Gesellschaftsformation und deshalb ging von ihnen auch nie eine ernsthafte Gefahr eines neuen Faschismus aus. Diese Totalisierung der Gemeinschaft der Demokraten, die hauptsächlich die Linke mit herbeigeführt hat, ist allerdings identisch und das zeigt sich heute mit ihrem Zerfall. Dieser wiederum ist im Selbstwiderspruch der postnazistischen Vergesellschaftung angelegt, in der der bereits erwähnte nazistische Kurzschluss von Staaten Subjekt im Modus permanenter Mobilmachung in den politökonomischen Formen im Doppelsinne aufgehoben ist. Seiner Substanz nach anerkannt und aufbewahrt, wie vorerst suspendiert und seiner Verlaufsform nachgezügelt. Also statt den Blockwarten gab es Aktenzeichen XY, da durfte sich jeder dann auch telefonisch dran beteiligen, aber richtige Jagdszenen gab es in der alten Bundesrepublik nicht oder nur in Ausnahmefällen. Taxiert selbst zu Zeiten der Prosperität jeder insgeheim seinen Erwerb als verkappte Arbeitslosenunterstützung, so mobilisiert die Krise der postnazistischen Vergesellschaftung erst Recht die Sehnsucht nach der alten Staatsunmittelbarkeit. Johannes Agnoli schrieb dazu schon in der Transformation der Demokratie 1966: „Der präfaschistisch liberale Ruf nach dem starken Staat wiederholt sich postfaschistisch neoliberal“. Und damit gerät das ganze System des autoritären Etatismus und geraten letzten Endes die politökonomischen Vermittlungen als solche wieder ins Visier des Volkszorns und es war wiederum die Linke, die noch zu Zeiten, wo keine Krise in Sicht war, im sinistren Tram nach Liquidation der Vermittlungen die Zunge gelöst und ihm neue fantasievolle und kreative, wie es so schön heißt, Äußerungsformen zur Verfügung gestellt hat. Sie war das Laboratorium, in dem die allgemeine Mobilmachung eingeübt und jener darauf zugeschnittenen neue und zugleich sehr alte Sozialcharakter herangebildet wurde, indem sich mittlerweile eine Mehrheit spontan wieder erkennt. Derjenige Sozialcharakter, der nach dem Motto „Ich leide, also bin ich“ sich einerseits unter Berufung auf die höchst unverwechselbare Diskriminierung, die ihm angeblich wiederfährt, zur kleinsten existierenden Minderheit erklärt, sich gleichsam nach dem Muster verfolgter und in ihrer Kultur bedrohter Völker begreift und andererseits als Gegensouverän seine private, warnhafte Feinderklärung allen anderen oktroyieren möchte und diesem Zweck entweder vorhandene gesellschaftliche Organisationen zu Rackets umfunktioniert, neue Rackets gründet oder andere Rackets mit ins Boot holt. Der einstige demokratische Fundamentalkonsens wird dadurch einerseits ins einzelne Subjekt zurückverlagert und andererseits vermittlungslos verallgemeinert. Aus der formell kollektiven Feinderklärung der Mitte gegen die Extreme, das war der Normalfall in der Bundesrepublik bis weit in die 80er Jahre, Terroristenhasse, einige werden sich noch daran erinnern. Aus dieser kollektiven Feinderklärung der gesellschaftlichen Mitte gegen die Extreme wird also die pluralisierte Feinderklärung alle gegen alle, die getrennt vereint sich zusammenrotten und auf diese Weise zerfällt die Gemeinschaft der wehrhaften Demokraten und reorganisiert sich zugleich hin zu zerfallen. Ein Zitat von Wolfgang Port in einem anderen Zusammenhang macht es sehr schön deutlich: „Wie durch höhere Gewalt sondern sich die Langen von den Kurzen, die Weiblichen von den Männlichen, die Alten von den Jungen, die Dicken von den Dünnen ab“ und das Resultat ist eine Segregation und Ghettoisierung durch welche die Metropolen, einem riesigen Freiluftgefängnis mit seinen Unterabteilungen für Männer und Frauen, Jugendliche, Kranke, Alte, Port schreibt etc., man könnte noch Schwule und Lesben und Migranten und was weiß ich noch alles ergänzen, Protestanten, Katholiken, Ossis, Wessis, immer ähnlicher werden. Neu ist, dass dieses Freiluftgefängnis als eine kulturelle Einrichtung und seine Insassen als Kulturbotschafter begriffen werden und es ist diese nahezu flächendeckende Selbstkulturalisierung der gesellschaftlichen Mehrheit und der einzelnen Individuen in ihr, die in der Postmoderne ihr bewusstloses Selbstbewusstsein und ihre Legitimation erfährt und im antirassistischen PC-Sprech sich ihren Ehrenkodex schafft, ihre Omertà, die sich an ihresgleichen und die verbliebenen Kritiker draußen richtet, Islamophobie ist ihr derzeit aktuellstes Schlagwort. Dieser Vorgang, diese Selbstkulturalisierung der gesellschaftlichen Mitte und ihr Zerfall ist also die Bedingung der neuen Haltung Ausländern und Migranten gegenüber, an denen die Deutschen projektiv ihre ersehnte Regression auf den Stamm illustrieren. Was ihnen umso leichter gelingt, als manch ihrer Repräsentanten und Lobbyisten sich anschicken, genau dem Bilde zu gleichen, das die Deutschen sich seit jeher von ihnen machten und wofür sie von ihnen jetzt nach kollektiv und offiziell ins Herz geschlossen werden. Der mittlerweile zur Dauereinrichtung erklärte Karneval der Kulturen ist nichts anderes als ein Zerfallsprodukt der postfaschistischen Demokratie, mehr noch, er ist diese Gemeinschaft in einer zugleich flexibilisierten und pluralisierten und kollektivierten Gestalt. In dieser Völkerfamilie, die die Deutschen gerne auf der ganzen Welt hätten, wären da nicht Israel und die USA als Störenfriede und die sie aus Mangel an Realisierungschancen deshalb erstmal bei sich zuhause einrichten, geht es dabei zu, wie in jeder guten Familie: Die einzelnen Mitglieder sind einander spinnefeind und die Widersprüche und Konflikte, die daraus resultieren, gehören auch voll und ganz dieser Vergesellschaftung an, sind von ihr konstituiert und dazu gehört ein fein dosiertes Spiel mit Fremdheit und Nähe, das von allen Beteiligten auch weiterhin gepflegt wird, weil damit ein moralisches Plus bei der Gefolgschaft eingefahren werden kann. (…) Der zweite Weltkrieg war ein kulturindustrielles Massenevent. (…) Eine neue Barbarei sei stets zu befürchten, wird sich nicht aus dem Geist Nationalsozialismus unmittelbar speisen, sondern im Gewande von demokratischem Antifaschismus von Lernen aus der Geschichte und political correctness daher kommen.(…) Abwehr des offenen Faschismus durch dessen demokratische Entnazifizierung und Eingemeindung. (…) Je antirassistischer und weltoffener sich die Deutschen aufführen, desto mehr ähneln sie wieder einer gegen ihre Todfeinde verschworenen Horde, die nicht mehr auf Exklusivität pocht, sondern die Anforderungen zum Mitmachen wieder flexibilisiert hat und sich ihr Jagdrevier mit anderen teilt, sofern sie sich bewähren. (…) Die postnazistische Demokratie hat die nationalsozialistische Mobilmachung des „gesunden Volksempfindens“ zwar nicht abgeschafft, sondern nur sistiert – sie hat es aber andererseits auch in die Latenz abgedrängt und damit gebremst, indem sie es in die mediatisierende Form des bürgerlichen Repräsentationsprinzips zwängte. (…) „Rassismus“ ist ein ideologisches Stichwort eines anti-rassistischen Rackets, das jeden Realitätsbezugs entbehrt, das seine Mitglieder vielmehr nur als Ausweis von Gesinnungsfestigkeit und Ehrbarkeit vor sich hertragen und das ihnen als probates Mittel dient, um nach Willkür und freiem Ermessen festzulegen, wer gerade als „Rassist“ zu gelten hat. Und dieses „anti-rassistische“ Racket, das sind heutzutage fast alle: längst ist die Gegnerschaft zum Rassismus keine Domäne der Linken mehr, sondern offizielle Staatsraison und common sense aller Ehrbaren und Wohlmeinenden, und das ist die erdrückende Mehrheit. (…) Von der moralisierenden Aufdringlichkeit und der enervierenden Verlogenheit einmal abgesehen, ist die Ehrfurcht, die „anderen Kulturen“ entgegengebracht wird und die Unterwürfigkeit, mit der ihre Träger geradezu als Heilsbringer verehrt werden, keine Gegenposition zum Rassismus, sondern dessen logische wie historische Voraussetzung, die im Rassismus und allen naturalisierenden Ideologien als ein Moment überlebt: deren Grundmuster ist die projektive Bekämpfung dessen, was man selbst gern möchte, aber nicht erreichen kann, und deshalb gehört zur Diskriminierung der Neger wegen ihrer „Faulheit“ die Bewunderung für den „Rhythmus, den sie im Blut haben“ und die Achtung vor ihrer „sagenhaften Potenz“; somit ist der „Anti-Rassismus“ nichts weiter als die notwendige Kehrseite des Rassismus selbst, die sich von diesem abgespalten hat und gegen ihre eigene Grundlage wendet. Historisch jedenfalls geht die Wertschätzung fremder Kulturen ihrer späteren, „rassisch“ legitimierten Abqualifizierung voran und sie ist auch logisch deren Voraussetzung: Christoph Columbus etwa beschreibt in seinen Tagebüchern die Eingeborenen, die er 1492 auf den Bahamas, Cuba und schliesslich Haiti angetroffen hat, folgendermaßen: sie sind „ängstlich und feige“, „sehr sanftmütig und kennen das Böse nicht, sie können sich nicht gegenseitig umbringen“, „sie begehren die Güter anderer nicht,“ und er resümiert: „Ich glaube nicht, dass es auf dieser Welt bessere Menschen oder ein besseres Land gibt.“ (7) (…) Protestantische Innerlichkeit: gemäß der Devise, dass vor der schlechten Tat der schlechte Gedanke und das schlechte Wort kommen, die man demzufolge austreiben muss, damit alles besser wird. (…) So kommt es, dass es heute der Anti-Rassismus ist, der, unter dem Vorwand, heldenhaft gegen einen in Wahrheit nicht existenten „Rassismus“ zu kämpfen, Respekt und Toleranz noch für die rückständigsten und unmenschlichsten Sitten und Gebräuche einfordert und damit selbst als Protagonist und Fürsprecher einer Verrassung der restbürgerlichen Gesellschaft fungiert. (..) Die unterschiedliche Pigmentierung der menschlichen Haut ist eine objektive Gegebenheit, keine bloße Erfindung. (…) Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums, integriert im barbarischen Kollektiv. (…) Der nervige Sozialcharakter des Gutmenschen ist offenbar eine fast zeitlose Erscheinung und in den verschiedensten Lebensbereichen anzutreffen, die Wahrscheinlichkeit, ihm in fortschrittlichen sogenannten „politischen Zusammenhängen“ zu begegnen, ist besonders hoch: werden doch hier traditionell die altruistischen Tugenden – das Mitgefühl, die Solidarität, Selbstlosigkeit etc. – besonders hoch angeschrieben und deshalb sind sie das geeignete Betätigungsfeld für Sozialcharaktere, die sich als Ersatz für ihr eigenes ungelebtes Leben vorzugsweise mit dem Leiden anderer als Fetisch verbinden. (…) Es sind aber gerade die höchsten Tugenden, die die niedersten Instinkte decken, wie schon Marx wusste: „Bis jetzt hat der Mensch sein Mitgefühl noch kaum ausgeprägt. Er empfindet es bloß mit dem Leiden, und dies ist gewiss nicht die höchste Form des Mitgefühls. Jedes Mitgefühl ist edel, aber das Mitgefühl mit dem Leiden ist die am wenigsten edle Form. Es ist mit Egoismus gemischt. Es neigt zum Morbiden […] Außerdem ist das Mitgefühl seltsam beschränkt […] Jeder kann für die Leiden eines Freundes Mitgefühl empfinden, aber es erfordert […] das Wesen eines wahren Individualisten, um auch am Erfolg eines Freundes teilhaben zu können. (…) Und da jeder demonstrative Altruismus nicht nur einen kleinlichen Egoismus bemäntelt, sondern auch mit dem Anspruch des Idealisten einhergeht, erzieherisch auf das Objekt seiner Zuwendung einzuwirken, ist er die adäquate Ideologie von Rackets, und auch das ist Wilde nicht entgangen: Barmherzigkeit, so schreibt er, sei die „lächerlich unzulängliche Art der teilweisen Rückerstattung oder ein sentimentales Almosen, gewöhnlich verknüpft mit dem skandalösen Versuch des rührseligen Spenders, auf (das) Privatleben (der Armen) Einfluss zu nehmen. (…) Im totalisierten Zugriff auf die ihr Unterworfenen ist die sozialistische Bewegung bis auf den heutigen Tag ebenfalls als ein Racket des Tugendterrors anzusprechen, betrachtet sie es doch als ihre Aufgabe, das Proletariat oder das gerade angesagte Subjekt seiner „wahren Bestimmung“ zuzuführen und d.h. es im Sinne der von ihm zu realisierenden Ideale zu erziehen – und das bedeutet stets noch: ihm die Untugenden und Laster auszutreiben, die der Vorhut als Male der individualistischen Bürgerwelt erscheinen: etwa Alkoholabusus, Faulenzerei, „zerrüttete“, „unsittliche“ Verhältnisse zwischen den Geschlechtern etc. Und um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen die selbsternannten Vertreter der Klasse die von ihnen verfochtenen Tugenden in eigener Person glaubwürdig verkörpern und deshalb in einer noch rigideren Weise als der gemeine Bürger sich als Subjekte zurichten, d.h. ihre Individualität dem Allgemeinen (dem Kollektiv, der Klasse, dem Frieden etc.) opfern, um totale Identität mit ihm zu erlangen. Wenn Identität letzten Endes den Tod bedeutet, dann hat die Bemühung um sie vorzeitige Erstarrung und prämortale Leblosigkeit zur Folge – von daher die bis in die Gegenwart zu beobachtenden verhockten, verkniffenen und lauernden Mienen aller professionellen Menschheitsbeglücker, ihre rigide Zwangsmoral und durchgängige Humorresistenz, die immergleichen offiziösen Phrasen, die sie dreschen, die tödliche Langeweile, die von ihnen und ihrem penetranten Sendungsbewusstsein ausgeht, und ihr chronisches Beleidigtsein, wenn sie beim Gegenüber auch nur den Hauch eines Zweifels an ihrer aufgetragenen Gutartigkeit zu erspüren glauben. Und zu alldem glauben diese Leute sich auch noch ermächtigt, diese ihre trostlose Existenz zur verbindlichen Richtschnur für alle anderen zu erklären.“ – Clemens Nachtmann
„Die rebellische Haltung, vor einem Jahrzehnt noch das Privileg von Einzelgängern, ist heute Ausdruck des Konformismus. Man will dazugehören, nicht als Schlappschwanz gelten“ – Horkheimer
„Wird Freiheit mit Zügellosigkeit verwechselt, entsteht Rücksichtslosigkeit.
Am Schluss Gleichmacherei.
Ihr seid aber nicht alle gleich.
Noch nie wart ihr alle gleich.
Ihr lasst es euch aber einreden.
So werdet ihr immer respektloser, ungenießbarer gegeneinander.
Vergeudet in Kleinkriegen eure Zeit, als hättet ihr ein zweites Leben.
Weil ihr tatsächlich alles verwechselt.
Behauptungen mit Beweisen.
Gerechtigkeit mit Maß.
Religion mit Moral.
Desinteresse mit Toleranz.
Satire mit Häme.
Reform mit Veränderung.
Nachrichten mit Wirklichkeit.
Kulturunterschiede haltet ihr für Softwarefragen und ihre Analyse ersetzt ihr mit Anpassung.
Ihr habt die Maßstäbe verloren.
Der Gordische Knoten ist ein Keks gegen eure selbstverschuldete Wirrsal.
Man geht immer fehl, sucht man den Ursprung menschlicher Handlungen außerhalb der Leidenschaft des menschlichen Herzens …
Der Separatismus gendert sich in die Köpfe, sitzt in Regierungen.
Männer sind keine Männer mehr. Frauen keine Frauen, sondern ‚Menschen mit Menstruationshintergrund’, Quote ist Trumpf.
Auf gar keinen Fall sollen Mann und Frau sich noch als zwei Teile eines Ganzen begreifen. Damit die Geschlechter noch mehr aneinander verzweifeln.
Bis alle in destruktiver Selbstbezogenheit stecken.
Am Ende: Mann ohne Eier. Frau ohne Welt.
Auf die Erschöpfung des Mannes wird aber nur die Erschöpfung der Frau folgen, das sage ich euch.
Auf die Verstörung der Kinder folgt die Zerstörung der menschlichen Schöpfung.“– Hans Dieter Hüsch
Es gibt zweierlei Ethik: die moralische, der die Realität egal ist und die der Verantwortung, die reale Folgen der ethischen Forderungen berücksichtigt. Die erste ist gut gemeint, die zweite ist gut gemacht.
Was dem einen seine Souveränität, ist dem anderen seine Eigenmächtigkeit.
Das Schöne am Euro war, dass die Gewinner immerzu gewinnen konnten, ohne dass ihnen gleich die Quittung präsentiert wurde. Denn sie verdienen ja am Ausland, was heißt, eigentlich ein im Maße des Verdienens zunehmend schlechtes Geld – das ist durch den Euro aufgehoben worden: Man konnte ständig an einer anderen Nation verdienen, ohne dass das Geld dieser Nation darunter gelitten hat, weil sie gar kein eigenes hat. Der Wert dieses Geldes repräsentiert nicht die Leistungsfähigkeit dieser Nation. So hat der Euro von dem innereuropäischen Verdienen aneinander sogar noch gelebt; er hat vor der Krise absurderweise nur den Konkurrenzerfolg der Gewinner repräsentiert.
— Das ist ja mit der Idylle charakterisiert. Dass zunächst mal alle Seiten Gewinner des neu eingeführten Euro waren. Auch die, die ihre vergleichsweise Weichwährung gegen den Euro getauscht haben und damit auf einen Schlag Kredit zu ganz anderen Konditionen und Möglichkeiten hatten. Insofern waren die späteren Verlierer erst mal auch Gewinner.
Stupidity is demonstrated by people lacking the knowledge they could achieve
Stupidity manifests itself as outraged moralism
Values without empathy are worth nothing
Some people feel physical pain when they should correct their accustomed ideas in favor of reality, they turn all their intelligence with the support of their aggression, for not to recognize the reality and maintain their self-image
More and more feel, think less and less – Man does not differ from animals by feelings, because mammals have the same feelings, like man, sadness, fear, anger, love, but by his thought. When he thinks, if he thinks.
Political correctness can be defined as the telling of a lie out of the cowardice in an attempt to avoid upsetting fools not willing to face up to the truth
“In arguments about moral problems, relativism is the first refuge of the scoundrel.” Roger Scruton
Antisemitism is when one blames the Jews or Israel for issues, he does not blame others
Islam is less a religion and more a totalitarian society, an ideology that demands absolute obedience and tolerates no dissent, no criticism, and prohibits the thinking, knowledge and recognition. True Islam is totally different, the one who will find it will receive a very high reward.
Craziness is, when one always does the same but expects a different outcome
If a monkey thinks “I am a monkey”, then it is already a human
A man with roots should go for a pedicure
Self smugness leads to idiocy, being pissed off leads to enlightenment
If someone has something to say, he can tell it always very easily. If someone has nothing to say, he says it in a very complicated way
Addiction is, when somebody does something he wants to do, yet seeks someone who can make it so he won’t do it and doesn’t want to, either.
If the clever people always gave in, the world would be reigned by idiots. Too much “cleverness” makes you stupid.
If one only fights evil to protect life, one produces nothing good at all and such a life then becomes no longer worth living and thus requires no protection, for it is already unlived due to such a total protection. One can spend so much money on insurance, that one has nothing left to insure. Safety works in the same way.
Happy slaves are the worst enemies of freedom.
Creativity is an intelligence having fun.
If working makes you sick, fuck off, leave the work!
If Germans talk about morality, they mean money.
A man without an insight is just an anxious, aggressive, unhappy monkey.
Thinking is always trespassing.
The mob, who calls himself the people, does not discuss, just defames.
Legal is not always legitimate.
Who can not do without, lives unhappy.
So called social, culture sciences, sociology, psychology psychotherapy, psychoanalysis, are not anymore scientific, but immanent religious cult-prophets, organized as sects.
Without a strong opposition any apparent democracy atrophies to a tyranny, and as well a science , to an attitude of a religious sect.
You can recognize everything from a certain distance only, who is zealous, outraged, who sticks his nose in something, this one has lost the perspective, he recognizes anything more, he has only his imagination of the world in his head. This creates paranoia, which is called religion, and a religion as politics, even as a science.
Islamists are a real danger, therefore they will not be seen as such. Jews are not a danger, therefore they are seen as such. It is how the perception by cowards functions.
People without a sense of humor are able only to fear or to hate and become monks or terrorists.
People are not equal, each single person is unique.
Insight applies to everyone, including Muslims, Albanians, women and homosexuals.
Islam belongs to Germany, Judaism belongs to Israel.
The totalitarian Terror of consensus is ubiquitous in Germany.
There are no discussions anymore, but defamations only.
It is a culture of the mob. As it has already been.
Harmony is only if you do not communicate.
One should never go to bed with someone who has more problems than you already have.
>>Evelyn Waugh, surely the wittiest novelist of the past century, in World War II, coming out of a bunker during a German bombing of Yugoslavia, looked up at the sky raining enemy bombs and remarked, “Like everything German, vastly overdone.”<< Joseph Epstein
One has to be brave, to have a wit.
Stupid and dull belong mostly together.
Charlie Hebdo: you don´t care if such murders are comitted to Jews, we will see how “adequate” you will react when (when, not if), Islamists will begin to bombard your cities with Kasam missiles.
Christopher Hitchens: “In a free society, no one has the right not to be offended.“
The more someone narcissistic inflates , the more he feels insulted and provoked.
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” – Bertrand Russell
The problem with the Islamists in Europe should be solved exactly as Europe requires to the Middle East: a two-state solution, a half for muslims and the another half for not-muslims , with a common capital.
What may satire? Everything! Except be understood by the fool, because then it was not a satire.
Islamimus is Islam preaching violence.
Islam is a religion of love, and he who doubts is dead.
War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. Islam is a peaceful religion of love – George Orwell 2015
Islam is not responsible for anything, Jews are guilty of everything.
Islamists are satanists. Islamism is a religion of idiots.
Within a wood.”
― Philip Larkin, Collected Poems
If someone inflates endless his ego, as Islamists do, then he hurts his own feelings already in his morning own shit.
“The seven deadly sins of modern society. Wealth without work pleasure without conscience, knowledge without character business without morality Science without humanity, worship without sacrifice Politics without principles”
-Mahatma Gandhi
“Where there is only a choice between cowardice and violence, I would advise violence.”
-Mahatma Gandhi
Heroes of today know nothing, can not and do not want anything. They just look like heroes, that’s all.
It may be that early fathers ate their children. Today, the mothers will eat anything, fathers, children and the rest. Everything Mommy, anyway!
Germany yesterday: the will to power.
Germany today: the will to blindness.
Germany tomorrow: 德國
German psychoanalysis? Great, like German charm, German humor and German wit.
The resistance starts with its own language other than that of the dictatorship.
Smart phones for stupid people.
A leftist can, but do not have to be stupid.
If you do not blame states, when they commit suicide with millions victims , so why to blame a co-pilot with 149 dead?
Only the purity of the means justify the end.
Everyone deserves a second chance. A second, not a twelfth, twenty-second or one hundred second.
In Poland, American intelligence officials have tortured their prisoners, while the Polish courts ran trials of Polish intelligence officesr who tortured Polish prisoners.
Better have any manners, than no manners at all.
1 x 1 materialist criticism: the aim must be to make appearances in a situation in which they are legible. (…) A new barbarism is always to be feared, is not directly powered from the spirit of National Socialism, but in the guise of democratic anti-fascism of learning from history and political correctness come along. (…) Defence of the open fascism by its democratic denazification and incorporation. – (…) The Second World War was a culture industry Massenevent.(..) Specialization and diversification are a contemporary manifestation of massification and uniformity. (…)
„Democracy is nothing more than the rule of the stick over the people by the people for the people. (…) There are three types of despots: the despot who enslaves the body, the despot who enslaves the soul and the despot who enslaves both body and soul. The first is called Prince. The second is called the Pope. The third is called the people. (..) If you want to lead the people, you are forced to follow the mob. (…) „The first duty in life is to be as artificial as possible. The second duty is still unknown. „„– Oscar Wilde
A German is a person who can speak no lie, without actually believe – Adorno